|
| |
|
|
|
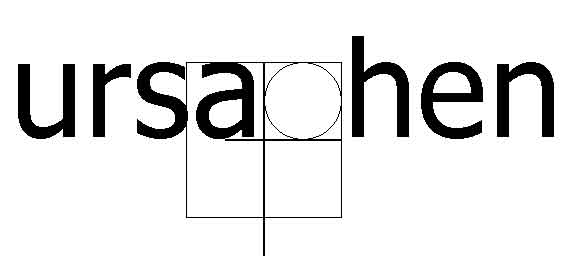 |
|
|
|
|
| Über die Ursachen der Hyperkinetischen Störung
ist seit der ersten umfassenden Beschreibung der Symptome durch George
F. Still vor rund einem Jahrhundert viel gerätselt und geforscht
worden. Dabei standen über die Jahre wechselnde Aspekte der
Verhaltensstörung im Mittelpunkt. Bereits Still ging jedoch davon aus,
dass es sich bei der von ihm in Universitätsvorlesungen dargestellten
Symptomatik um die Folgen einer Besonderheit des Gehirns handelte.
Was er in der Fachsprache seiner Zeit einen "Defekt der moralischen
Kontrolle" nannte, konnte er anhand von 43 Fällen - in der Mehrzahl
Jungen - verdeutlichen: Verweigerungshaltung, extreme Emotionalität,
eingeschränkte Daueraufmerksamkeit und ungenügendes regelgeleitetes
Verhalten. Bei der Auswahl der Kinder hatte er streng darauf geachtet,
dass sie weder geistig behindert waren noch aus chaotischen oder lieblosen
Familienverhältnissen stammten. Still folgerte daraus, dass das
auffällige Verhalten der beobachteten Kinder nicht durch die Umgebung
hervorgerufen worden sein könne, sondern einer mangelnden Entwicklung der
willentlichen Hemmung des Verhaltens entspringe. Für diese ungenügende
Kontrolle machte er noch unbekannte hirnorganische Defizite
verantwortlich. (1)
|

"[...] the control of activity in conformity
with moral consciousness is markedly defective." Still
(1902) |
|
Der Stand der Forschung 2002
|
| Im folgenden finden Sie eine Beschreibung
aktueller neurobiologischer Befunde zur Hyperkinetischen Störung. Die
Darstellung stützt sich dabei im wesentlichen auf eine Übersichtsarbeit
von Gunther Moll und Aribert Rothenberger, die 2001 in einem Sonderheft
der Kinderärztlichen Praxis mit dem Titel "Unaufmerksam und
hyperaktiv" veröffentlicht wurde. (2) Passagen, die über diese
Quelle hinausgehen sind mit entsprechenden Literaturverweisen
gekennzeichnet.
|
|
Genetik
|
|
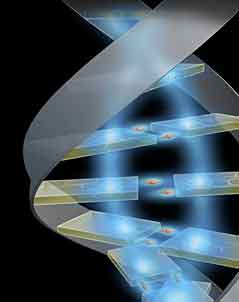
Die Erbinformation
lebender Zellen und Organismen - das sogenannte Genom - ist in
der DNA (englisch: Desoxyribo-Nucleic- Acid) oder DNS (Desoxyribo-Nuklein-
Säure) enthalten. Der chemische Aufbau und die molekulare Struktur
der DNA ist in allen Lebewesen identisch, gleichgültig ob es sich
um Mensch, Tier oder Pflanze handelt.
Die DNA ist ein
unverzweigtes Fadenmolekül mit einem Grundskelett aus Zucker und
Phosphorsäure und vier verschiedene organische Basen. Diese
"Buchstaben" stellen die Erbinformation dar. Die Erbinformation
einer menschlichen Zelle besteht aus ca. 3 Milliarden dieser Buchstaben,
wobei jeweils eine Hälfte davon von der Mutter und vom Vater stammt. |
Bis heute beruhen Annahmen zur genetischen
Veranlagung von bestimmten Verhaltensweisen oder Krankheiten auf einer
nicht immer tragfähigen Basis: einer überzufällig häufigen
Übereinstimmung von einzelnen Symptomen unter Verwandten und/oder
Trägern ähnlicher genetischer Besonderheiten. Variieren die Symptome mit
den Genen, so geht man davon aus, dass die Gene zumindest einen Teil der
Varianz erklären. Je schwächer der Zusammenhang ist, desto stärker
werden die gleichen Symptome unterschiedlicher Menschen durch andere
Faktoren beeinflusst.
Dieses Modell ist durchaus überzeugend, sofern die Gene als Träger
der Erbinformation das Leben tatsächlich auf immer gleiche Weise
bestimmen. Um auszuschließen, dass bei vergleichbarer genetischer
Ausstattung nicht die Umwelt - z.B. die Lebensbedingungen der prägenden
ersten Lebensjahre - ein Symptom hervorgebracht hat, suchen
Wissenschaftler daher nach Menschen, die bei möglichst gleichen Genen in
unterschiedlichen Umwelten aufwuchsen. Im Idealfall handelt es sich dabei
um eineiige Zwillinge, die sich seit ihrer Geburt getrennt voneinander
entwickelten. Studien, die auf eine größere Gruppe separierter Zwillinge
zurückgreifen können, sind sehr selten. Manche verblüffenden Befunde
haben sich außerdem in der Vergangenheit als "frisiert" oder
gar frei erfunden herausgestellt. (3) Dennoch geht man heute davon aus,
dass rund 80% des für die Hyperkinetische Störung eigentümlichen
Verhaltens auf die genetische Veranlagung eines Menschen zurückzuführen
sind. Diese Zahl ist allerdings ein Schätzwert, der sich aus der
Häufigkeit von betroffenen eineiigen Zwillingspaaren ergibt. Das heißt:
von 10 Zwillingspaaren mit zumindest einem hyperkinetischen Kind wurde in
8 Fällen auch beim Geschwisterkind eine Hyperkinetische Störung
diagnostiziert. Daraus darf allerdings nicht der Schluss gezogen werden,
dass die Symptome der betroffenen Kinder in ihrer Mehrzahl
allein durch die genetische Veranlagung bedingt sind. Gene sind lediglich
ein Informationsmuster, aus dem heraus sich das Leben in Wechselwirkung
mit der Umwelt entwickelt. Die Psyche und ihre Störungen sind das
Resultat eines vielschichtigen Prozesses, bei dem die natürliche
Grundlage der Hyperkinetischen Störung nur ein Faktor unter vielen ist. |
| Einige Studien legen nahe, dass bestimmte Gene
an der Ausbildung einer Hyperkinetischen Störung zumindest beteiligt
sind. Dazu zählen nach derzeitigem Wissensstand v.a. das Dopaminrezeptor-D4-Gen
sowie das Dopamintransporter-Gen. (4) Auch diese Befunde gelten
jedoch nur unter Vorbehalt, denn sie geben gleichfalls statistische
Zusammenhänge wieder, die nicht erkennen lassen, wie man sich eine
störungsspezifische Ausprägung der genetischen Veranlagung sowie ihre
Beeinflussung durch die Umwelt vorzustellen hat. Von einem Gentest der
Hyperkinetischen Störung ist die Medizin sicher noch viele Jahre
intensivster Forschung entfernt.
Nicht zuletzt lässt das überzufällig häufige Auftreten
verschiedener - mutmaßlich zumindest teilweise biologisch begründeter -
Störungen des Lernens und Verhaltens in Verbindung mit der
Hyperkinetischen Störung eine teilweise gemeinsame genetische Anlage
annehmen. Doch auch hier gilt: Ähnliche oder gar gleiche Symptome
können in den verschiedenen Kontexten ihres Auftretens unterschiedliche
Ursachen haben. Kontext fasst dabei die jeweiligen Bedingungen
zusammen - d.h. alleiniges Auftreten der Störung oder in Verbindung mit
anderen Krankheiten, Auftreten an bestimmten Orten (Familie, Schule,
Urlaub) oder generell, Auftreten v.a. unter Stress oder auch in Zeiten
geringer psychischer Anspannung. So weisen Symptome der motorischen
Unruhe oder auch der Unaufmerksamkeit auf zahlreiche ganz unterschiedliche
denkbare Ursachen hin. Das gleiche gilt für das gemeinsame Auftreten von
Symptomen verschiedener Störungen. Da mit Vorliegen einer
Hyperkinetischen Störung die Wahrscheinlichkeit von Lern-
und Leistungsstörungen deutlich steigt, erscheint es naheliegend,
dass z.B. die Legasthenie einige ihrer Entstehungsbedingungen mit der
Hyperkinetischen Störung teilt. Es könnte aber auch sein, dass ein
wesentlicher Teil des Zusammenhangs auf das ungünstige Lernverhalten
hyperaktiver Kinder zurückzuführen ist, die aus diesem Grund das Lesen
und Schreiben nur sehr langsam erlernen und/oder ihre diesbezüglichen
Bemühungen nach einigen deprimierenden Schuljahren ganz aufgeben. Gen-
und Umweltwirkung können aus der Perspektive unseres heutigen Wissens
nicht getrennt betrachtet werden.
Selbst die Abfolge des ersten Auftretens von Symptomen der
Hyperkinetischen Störung lässt auf abweichende genetische Faktoren
schließen. Treten beispielsweise Tics (vgl. Tourette-Syndrom)
nach der Hyperaktivität auf, so handelt es sich wahrscheinlich um das
gemeinsame Vorliegen getrennt zu sehender Störungen, während
Hyperaktivität als (häufige) Folge einer Tic-Störung auf eine
gemeinsame genetische Grundlage beider Symptomgruppen (Syndrome)
schließen lässt. Aus der genetischen Disposition, d.h. der
biologischen Ausstattung eines Menschen bei der Geburt, kann man seine
Entwicklung nicht vorhersagen. Und das liegt nicht allein an unserem
heute noch sehr begrenzten genetischen Wissen. Es ist ein Naturgesetz des
Lebens, dass es nicht nach festen Plänen reift, sondern sich unter dem
Einfluss der Umwelt entwickelt, um sich immer wieder neu an veränderte
Bedingungen anpassen zu können. |
Chromosomen
Die DNA befindet sich in Chromosomen
verpackt im Zellkern jeder Zelle und ist pro Zelle insgesamt etwa
zwei Meter lang.
Die DNA mit ihrer Information wird
nicht nur von Generation zu Generation vererbt, sondern muss auch bei
jeder Zellteilung verdoppelt und an die Tochterzellen weitergegeben
werden.
Die Erbinformation ist zwar in der
Basenabfolge der DNA - den "Buchstaben" - gespeichert. Ihre
Wirkung entfaltet sie jedoch nur in den Proteinen (Eiweiße). Auch
Proteine sind Fadenmoleküle aus verschiedenen Bausteinen, den Aminosäuren,
deren Reihenfolge die Eigenschaften des Proteins bestimmt. Mit Hilfe des
sogenannten genetischen Codes - drei Basen der DNA entsprechen
jeweils einer Aminosäure im Protein - wird die Basenabfolge der DNA auf
die Abfolge der Aminosäuren im Protein übertragen.
Alle Unterschiede zwischen
verschiedenen Tier- und Pflanzenarten, aber auch zwischen Lebewesen
derselben Art beruhen auf immer gleich kodierten Unterschiedenen in den
Proteinen, die wiederum in der Basenabfolge der DNA gespeichert sind.
Dieser Vererbungsmechanismus ist die Grundlage aller Lebewesen auf diesem
Planeten. |
Evolution und Entwicklung
|
|
| Im Rahmen der Diskussion um die genetischen
Grundlagen der Hyperkinetischen Störung ist seit dem Erscheinen des
Buches Attention Deficit Disorder - A Different Perception (1993)
des Amerikaners Thom Hartmann eine Auseinandersetzung darüber
entstanden, ob die Defizite der Hyperkinetischen Störung als überkommene
Vorteile einer früheren Zeit zu verstehen seien. Kurz gesagt nimmt der
Autor - selbst Vater eines hyperaktiven Kindes - an, dass Gesellschaften
der Frühzeit eine Unterscheidung in Jäger und Sammler kannten. Während
das Wesen, das er den Sammlern unterstellt, dem umsichtigen Verhalten in
modernen bürokratischen Industriegesellschaften entspreche, seien die
hyperaktiven Menschen von heute Nachkommen der Jäger. (5) Nachdem das
Buch in den USA große Popularität erreichte, haben amerikanische
Psychiater die Theorien von Hartmann aufgegriffen und recht wohlwollend
diskutiert. (6) Auch Moll und Rothenberger erwähnen diese Sichtweise in
ihrem Artikel in der Kinderärztlichen Praxis.
Ungeachtet des Umstandes, dass Hartmanns Idee einleuchtend ist und
ihren Zweck, nämlich eine für (s)ein Kind verständliche Erklärung der
Hyperkinetischen Störung und ihrer Folgen zu bieten, durch anschauliche
Vergleiche erfüllt, ist die empirische Grundlage seiner Theorie dünn.
Das gleiche gilt für die wissenschaftlich verbrämten Erläuterungen der
amerikanischen Psychiater. So geht Hartmann von einer sehr
bildhaft-konkreten Vorstellung frühgeschichtlicher Gesellschaften aus,
für deren mutmaßliche Struktur wir kaum überlieferte Zeugnisse haben.
Mehr noch: Selbst wenn damalige Jäger und Sammler tatsächlich so lebten,
wie Hartmann sich das vorstellt, sind die beobachteten Defizite
unaufmerksamer und hyperaktiver Menschen für die Jagd kein Vorteil.
Dabei bleibt noch unberücksichtigt, dass die Zivilisationsgeschichte der
vergangenen Jahrhunderte den Menschen vom Mittelalter ins
Computerzeitalter katapultierte - mit vielfältigen Anpassungen unserer
Wahrnehmung und Informationsverarbeitung an neue Umweltbedingungen. Es ist
daher unverständlich, warum beispielweise die Intelligenzleistung der
Menschen in den Industriegesellschaften, die auf vielfältigen und höchst
komplizierten Prozessen im Gehirn beruht, seit Beginn der
Intelligenzmessung von Generation zu Generation beständig ansteigt,
während die Anpassung von "Jägern" an die seit der Antike
bestehenden Schriftkulturen über mehrere tausend Jahre fehlgeschlagen
sein soll. Angesichts der beim "normalen" Menschen
hochadaptiven, d.h. auf eine stets verbesserte Umweltanpassung
ausgerichteten Hirnfunktionen ist es einleuchtender, von einem -
nichtsdestotrotz erblichen - Hirnfunktionsdefizit auszugehen, das seine
Ursache gerade nicht in einem evolutionären, d.h. natürlich zu
optimierenden Vorgang der Anpassung hat.
|

Wenn Sie bis hierher unvoreingenommen gelesen haben,
hoffe ich, dass Sie sich inzwischen mit dem Gedanken angefreundet haben,
dass ADD weder ein Mangel noch eine Störung ist. Es ist statt dessen eine
ererbte Kombination von Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Persönlichkeitsmerkmalen, die einem Jäger, Krieger oder Fährtensucher
zum Erfolg verhelfen und einen Farmer oder Buchhalter mit Sicherheit in
die Katastrophe führen würden.
Thom Hartmann
ADD - Eine andere Art, die Welt zu sehen
Schmidt-Römhild (1997) S.43
Zur Kritik an Hartmanns Buch vgl. die Rezension |
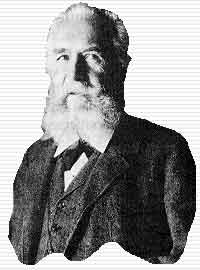
Ernst Haeckel
Zwölfter Vortrag.
Entwickelungsgesetze der organischen Stämme und
Individuen. Phylogenie und Ontogenie (7)
Inhaltsverzeichnis:
Entwickelungsgesetze der Menschheit: Differenzierung und
Vervollkommnung. Mechanische Ursache dieser Grundgesetze.
Fortschritt ohne Differenzierung und Differenzierung ohne Fortschritt.
Entstehung der rudimentären Organe durch Nichtgebrauch und Abgewöhnung.
Ontogenesis oder individuelle Entwickelung der Organismen.
Allgemeine
Bedeutung derselben. Ontogenie oder individuelle Entwickelungsgeschichte
der Wirbelthiere, mit Inbegriff des Menschen. Eifurchung. Bildung der drei
Keimblätter. Entwickelungsgeschichte d. Centralnervensystems, der
Extremitäten, der Kiemenbogen und des Schwanzes bei den Wirbelthieren.
Ursächlicher Zusammenhang und Parallelismus der Ontogenesis und
Phylogenesis, der individuellen und der Stammesentwicklung. Ursächlicher
Zusammenhang und Parallelismus der Phylogenesis und der systematischen
Entwickelung. Parallelismus der drei organischen Entwickelungsreihen.
|
Seit der berühmten Aussage des
Jenaer Arztes und Zoologen Ernst Haeckel, die Ontogenese sei eine
Rekapitulation der Phylogenese, haben sich viele Wissenschaftler, darunter
zahlreiche Psychiater und Psychologen, diese Sichtweise zueigen gemacht. Ontogenese, das ist die Seinswerdung des Menschen, das heißt seine
Entwicklung von der ersten Zelle im Leib der Mutter bis zu seiner vollen
Reife und zum Tod. Phylogenese ist demgegenüber die stammesgeschichtliche
Entwicklung, also gewissermaßen der umgekehrte Stammbaum eines jeden
Menschen bis in die Frühzeit der Menschheit und davor. Haeckel vertrat
die Ansicht, dass das Wachsen von Körper und Geist entsprechend den
Stadien der Stammesgeschichte verlaufen würde: die Eizelle entspräche
dem Beginn des Lebens, der Fötus einem Tier, das Baby einem Menschen der
Frühzeit, das Kind einem solchen der Steinzeit - und erst der erwachsene
Mensch würde in seiner individuellen Entwicklung jenen Gipfel erreichen,
den die Menschheit stammesgeschichtlich in den abendländischen
Gesellschaften erreicht habe. (7) Obwohl Haeckel kein Vertreter der
Darwin'schen Vorstellungen vom Sieg des Stärkeren in der
Evolutionsgeschichte - der sogenannten "natürlichen Selektion"
- war, wurde er von den Rassentheoretikern des Dritten Reiches
vereinnahmt. Dennoch gab und gibt es auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch
Theorien, die v.a. in der Entwicklung der Affekte sowie des Denkens an
Haeckels Überlegungen anknüpfen. (8) Inzwischen sind die Ähnlichkeiten, aber auch die Unterschiede in der
Entwicklung von Mensch und Menschheit anhand von vielen Details
wissenschaftlich untersucht und dargestellt worden. Dabei hat sich für
die Evolution gezeigt, was für die Sozialisation gilt: Entwicklung ist
ein Wechselspiel von Reifungsfaktoren und Umweltbedingungen. Und das gilt
sowohl für die "normale", d.h. allgemein übliche Entwicklung,
als auch für die abweichende Entwicklung unter dem Vorzeichen einer
Störung. Die Hyperkinetische Störung eines Menschen ist nicht
unabhängig von seinem angeborenen Temperament zu begreifen. Sie kann in
ihrer konkreten Symptomatik jedoch genauso wenig ohne Rückgriff v.a. auf
die Entwicklungsbedingungen der Kindheit jedes einzelnen Menschen erklärt
werden. Die Entwicklung eines Kindes beginnt nicht bei Null - die
Stammesgeschichte des Menschen ist in jedem Stadium seines Wachsens
umfassend gegenwärtig, ohne in allen Details nochmals durchlebt werden zu
müssen oder gar für die Gegenwart stets entscheidend zu sein. In
diesem Sinne zeigen sich bei der Hyperkinetischen Störung sowohl Entwicklungsverzögerungen
als auch Entwicklungsabweichungen. So weisen EEG-Befunde auf
Besonderheiten in den Frequenzbändern der Hirnströme hin. Die für das
Alter der hyperaktiven Kinder zu hohen Anteile langsamer (Theta-)Wellen
sind auch bei Kindern mit anderen externalisierenden, d.h. nach außen
gerichteten, meist aggressiven Verhaltensweisen gefunden worden. Im
Jugendalter konnte bei den Betroffenen jedoch kein Unterschied mehr zu den
EEG-Befunden nicht verhaltensauffälliger Jugendlicher beobachtet werden.
Grundlage dieser Entwicklungsverzögerung ist vermutlich eine späte
Ausreifung sensorischer Systeme zur Reizweiterleitung und
-verarbeitung bei Wahrnehmungsprozessen. Entwicklungsabweichungen fanden
sich demgegenüber v.a. bei der frontalen, d.h. die vorderen Bereiche des
Gehirns betreffenden Aktivität. Sie wurden jedoch nicht bei allen
hyperaktiven Kindern beobachtet. Obwohl sie offenbar ohne erkennbaren Wert
für die normale Hirnentwicklung sind, ist unklar, warum diese
Abweichungen auftreten und inwieweit sie mit den Symptomen der
Hyperkinetischen Störung zusammenhängen. Wie im Fall der
genetischen Disposition ist die Medizin von einer Diagnostik der
Hyperkinetischen Störung anhand von physiologisch messbaren
Entwicklungsdaten weit entfernt. Die Bedeutung des EEG im Zusammenhang mit
der Störung liegt v.a. in der Diagnose einer Epilepsie, deren Behandlung
wichtig ist und insbesondere für die medikamentöse Therapie der
Hyperaktivität erhöhte Aufmerksamkeit verlangt. |
|
Neurophysiologie und Neuropsychologie
|
|

Endlich kann ich das Vergnügen haben, Ihnen einen
Entwurf meiner Abhandlung: Über die Verrichtungen des Gehirns, und über
die Möglichkeit, mehrere Fähigkeiten und Neigungen aus dem Baue des
Kopfes und Schedels zu erkennen, mitzutheilen. Franz
Joseph Gall
Brief an Joseph Freiherr von Retzer (1798)
Gall war der Begründer der Phrenologie, einer Lehre, die erstmals
bestimmtes Verhalten in einzelnen Bereichen des Gehirns verortete. |
Neurophysiologische Vorgänge sind Abläufe im
Gehirn, die mit physikalisch messbaren Veränderungen einhergehen. Dazu
zählen alle Formen der Hirnaktivität, die z.B. mit EEG
(Hirnstrommessung) oder bildgebenden Verfahren (z.B. PET -
Positronen-Emissions-Tomographie - eine Form der Computer-Tomographie)
beobachtet werden können. Darüber hinaus soll in diesem Abschnitt auch
kurz auf untersuchte Abweichungen der Hirngestalt, also auf
unterschiedliche Größen und Formen bestimmter Bereiche des Gehirns
eingegangen werden, da auch sie neurophysiologische Informationen
darstellen. Bereits seit mehr als 20 Jahren werden Forschungen
angestellt, die abweichende Hirnstrukturen bei Vorliegen eines
Hyperkinetischen Syndroms zeigen sollen. Tatsächlich sind solche Befunde
beschrieben worden: im Bereich der vorderen Großhirnrinde, des Corpus
callosum (Balken, der beide Seiten der Großhirnrinde miteinander
verbindet), des Nucleus caudatus (Teil des Striatums, das für die
Steuerung des Bewegungsapparates wichtig ist) sowie des Kleinhirns.
Die bisherigen Erkenntnisse sprechen für eine abweichende Entwicklung des
Gehirns bei hyperkinetischen Menschen. Allerdings waren die untersuchten
Patientengruppen aufgrund von Aufwand und Kosten der dazu eingesetzten
bildgebenden Verfahren i.d.R. sehr klein. Ob der meist verminderten
Ausdehnung bestimmter Hirnstrukturen im Fall von an der Hyperkinetischen
Störung leidenden Kindern tatsächlich eine auch im Erwachsenenalter
nachweisbare systematische Abweichung in der Hirnentwicklung zugrunde
liegt, ist noch offen. Der Umstand, dass viele Steuerungsfunktionen - z.B.
nach Schädigung von Arealen durch Unfälle - durch andere, ursprünglich
nicht dafür gebrauchte Bereiche des Gehirns übernommen werden können,
zeigt, wie groß gerade die ortsübergreifende Wandlungsfähigkeit des
menschlichen Gehirns ist. Insbesondere im Kindes- und Jugendalter, das
sich durch eine besonders intensive (Um-)Strukturierung von Hirnfunktionen
auszeichnet, sind derartige Größen- und Formbefunde häufig nicht stabil
oder stehen trotz Stabilität in keinem festen Zusammenhang mit bestimmten
Verhaltensweisen. |
| Neben den Informationen über die Größe und
Form verschiedener Hirnareale, die an lebenden Menschen i.d.R. nur
durch bildgebende Verfahren gewonnen werden können, sind für die
Hyperkinetische Störung vor allem physiologische Daten interessant. Diese
kann man heute gleichfalls durch bildhafte Aufnahmen des Gehirns erheben,
aber beispielsweise auch durch die Messung von Hirnströmen, Hautleitfähigkeit,
Herzschlag oder Reaktionszeiten. Interessant sind solche
Ergebnisse, weil Impulsivität, hyperkinetisches Verhalten und Defizite in
der Aufmerksamkeitskontrolle auf abweichende Steuerungsfunktionen
hinweisen, die möglicherweise nicht nur im Alltag beobachtbar sind,
sondern von der Mehrheit der Betroffenen unter immer gleichen Bedingungen
stets wieder gezeigt werden. In diesem Fall müsste man von
einer generellen Beeinträchtigung der Exekutiven Funktionen ausgehen
- jener Steuerungsprozesse, die im Frontalhirn, d.h. in der vorderen
Großhirnrinde angesiedelt sind.
Ein solches generelles Selbststeuerungsdefizit wurde bereits von Still
1902 angenommen, der erkannt hatte, dass das Verhalten der von ihm
beschriebenen Kinder dem von Unfallopfern mit Schädigungen bestimmter
Bereiche des Gehirns ähnlich war. (1, s.o.) Gerade diese Ähnlichkeit
führte schließlich dazu, der Störung selbst den Namen Minimal Brain
Damage (Minimaler Hirnschaden) bzw. später auch Minimale
Cerebrale Dysfunktion zu verleihen. Das "minimal" trug
dabei dem Umstand Rechnung, dass man diesen mutmaßlichen Schaden bzw. die
vermutete falsche Funktion einzelner Bereiche des Gehirns nicht messen und
daher auch nicht beweisen konnte. Die modernen computerberechneten
Aufnahmen von Hirnschichten erlauben es heute jedoch, die vor rund hundert
Jahren erstmals diskutierten physiologischen Grundlagen der Störung
abzubilden.
Im Mittelpunkt steht dabei die Verminderte Aktivität in Bereichen des
Frontalhirns sowie der Basalganglien, zu denen Striatum (u.a. mit dem
Nucleus caudatus), Pallidum, Substantia nigra und der Nucleus
subthalamicus zählen. Während das Frontalhirn für die Exekutiven
Funktionen verantwortlich ist, steuern die Basalganglien v.a. die
motorischen Prozesse, wobei den inhibitorischen, d.h. das Verhalten
hemmenden Funktionen des Dopamin-Stoffwechsels hier eine entscheidende
Rolle zukommt. Aus vielen Studien nicht allein zum Hyperkinetischen
Syndrom wissen wir, dass insbesondere das Striatum über den Botenstoff
Dopamin bei der Ausbildung von Erkrankungen der Bewegungsabläufe
beteiligt ist, so u.a. auch beim Morbus Parkinson, verschiedenen Formen
der Chorea ("Veitstanz") oder sogenannten Dyskinesien durch die
neuroleptische Behandlung von Schizophrenien. Da der Dopamin-Stoffwechsel
auch die Aktivität des Frontalhirns beeinflusst, zeigen
neurophysiologische Studien bei Hyperkinetikern eine Minderdurchblutung
dieses für die Exekutiven Funktionen zuständigen Hirnareals, während
der sensomotorische Kortex, der in der Hirnrinde Bewegungsinformationen
verarbeitet, eher zu stark und diffus durchblutet zu sein scheint. Die
Beziehung zwischen der Aktivität in einzelnen Bereichen v.a. des
Frontalhirns einerseits und hyperkinetischem Verhalten andererseits
variiert jedoch zwischen den Geschlechtern und ändert sich während der
Entwicklung vom Kindes- ins Erwachsenenalter. (9) Die geringere
Aktivität des Frontalhirns und die damit verbundene Einschränkung der Exekutiven Funktionen bringt im Alltag eine Reihe von kognitiven Defiziten
mit sich. Insbesondere der amerikanische Neuropsychiater Russel A. Barkley
hat sich der Beschreibung dieser Mängel angenommen: Beeinträchtigung des
Arbeitsgedächtnisses, Behinderung der bewussten Handlungsplanung
und -steuerung, eingeschränkte Selbstregulation von Stimmung,
Motivation und Erregung sowie eine reduzierte Rekonstitutionsfähigkeit,
d.h. eine verminderte Fähigkeit zur Analyse und Neuordnung
vielschichtiger Strukturen und Abläufe. (10) Klinische Beobachtungen
haben dabei ergeben, dass sich die Defizite in den Exekutiven Funktionen
vor allem in Stresssituationen zeigen, die angesichts komplexer, schwer zu
durchschauender Aufgaben mit mehreren zu beachtenden Aspekten
Hyperkinetikern die Steuerung der Aufmerksamkeit sowie die Kontrolle des
eigenen Verhaltens erschweren. Wissenschaftler vermuten daher, dass eine
spezifisch verminderte Fähigkeit zur Fokussierung, d.h. Konzentration der
Hirnaktivität auf bestimmte Aspekte einer Situation nicht nur die
Aufmerksamkeit belastet, sondern insbesondere eine zielgerichtete Hemmung
der Motorik verhindert. Zusammenfassend deuten die aktuellen
neurophysiologischen und neuropsychologischen Befunde auf eine Einheit von
abweichender Ausbildung einzelner Hirnareale, grundsätzlicher
Mindererregung des frontalen Kortex sowie nicht hinreichender
situationsabhängiger Aktivierung von Hirnfunktionen bei Vorliegen einer
Hyperkinetischen Störung hin. Inwieweit diese besondere physiologische
Disposition der betroffenen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen auf stabile
genetische Ursachen zurückzuführen oder aber durch Einflüsse der
Umwelt v.a. in der Kindheit veränderbar sind, bleibt weitgehend
ungeklärt. Im Rahmen umfassender neuer Erkenntnisse über die Entwicklung
des Gehirns zeichnet sich jedoch ein übergreifendes Verständnis von
Anlage und Prägung ab. Abhängig von einem Ausgangsniveau der
Selbstregulation, die man als das angeborene Temperament bezeichnen kann,
kommt Umweltbedingungen wie Reizüberflutung und v.a. ungenügend
strukturiertem elterlichem Erziehungsverhalten ein erheblicher
verstärkender Einfluss auf die Ausbildung abweichender Hirnfunktionen
zu. |

Die
Resultate der Münchener Gruppe
zeigten aber nicht nur die Störung der Dopamin-
Transporter, sondern belegten erstmals in vivo und intraindividuell bei
Patienten mit ADHS, dass der
gestörte Stoffwechsel durch Methylphenidat korrigiert wird: Unter Gabe
von 3 x 5 mg täglich fand
sich nach vier Wochen bei allen Patienten eine deutliche Reduktion der
Dopamintransporter-
Konzentrationen, die bereits unter dieser niedrigen Dosis im Mittel sogar niedriger
lagen als beim Kontrollkollektiv. Bei Normalpersonen konnten
Volkow et al. in einer PET- Untersuchung mit [C-11]Cocain gleichfalls
eine Abnahme der Dopamintransporter unter Methylphenidat nachweisen.
Zusammenfassend bestätigen diese neuesten SPECT-Untersuchungen die
Vermutung, dass bei der ADHS eine
spezifische Störung des Dopamin-
Systems im Striatum vorliegt, die
sich durch Einnahme von Stimulanzien korrigieren lässt.
Klaus-Henning
Krause, Stefan Dresel & Johanna Krause
Neurobiologie der Aufmerksamkeitsdefizit-/
Hyperaktivitätsstörung
In: Psycho 26 (2000) S.204
|
Hirnstoffwechsel - Dopamin und Noradrenalin
|
| Die größte öffentliche Aufmerksamkeit auf der
Suche nach den Ursachen der Hyperkinetischen Störung gilt derzeit dem
Stoffwechsel im Gehirn, hier insbesondere dem oben bereits angesprochenen
Neurotransmitter Dopamin. Neurotransmitter sind Botenstoffe,
die im Gehirn für die Kommunikation zwischen den Gehirnzellen, den Neuronen,
sorgen. Sie werden im Körper selbst hergestellt und sind am
Informationsaustausch innerhalb des gesamten Nervensystems beteiligt. Das
Dopamin gehört zu einer Gruppe von Aminen, die Catecholamine genannt
werden und u.a. die Aktivierung des Zentralnervensystems bewirken. Es wird
über ein Zwischenstadium aus Tyrosin, einer natürlichen Aminosäure
hergestellt, und ist seinerseits die Vorstufe von Noradrenalin und
Adrenalin. Dopamin ist zudem entscheidend für die Steuerung von
Bewegungsabläufen.
Eine Reihe von aufwendigen wissenschaftlichen Untersuchungen hat in den
letzten Jahren gezeigt, dass Erwachsene, die Symptome der Hyperkinetischen
Störung zeigen, eine um ca. 70% erhöhte Zahl an Dopamintransportern im
Striatum aufweisen. (9) Das Striatum gehört wie die Substantia nigra, dem
Produktionsort des Dopamin im Gehirn, zu den Basalganglien (s.o.). Da die
Dopamintransporter für den Rücktransport von Dopamin aus dem Spalt
zwischen zwei miteinander verbundenen Nervenenden verantwortlich sind und
durch ihre Häufigkeit die Reizweiterleitung beeinflussen können, wurde
vermutet, dass dieser Überschuss an Dopamintransportern die
Aktivierung des Frontalhirns behindert. Wird nämlich das freie
Dopamin im Spalt zu schnell wieder abtransportiert, kann nicht genug
Dopamin am anderen Ende des Spaltes an die nächste Zelle andocken und sie
aktivieren. Für diese Dopaminmangelhypothese spricht auch die
Wirkung der gängigsten Medikamente gegen die Hyperkinetische Störung,
der Psychostimulanzien. Der weilweit am häufigsten eingesetzte
Wirkstoff Methylphenidat (u.a. Ritalin bzw. Medikinet) sorgt zwar zu
10-15% dafür, dass mehr Dopamin in den Spalt abgegeben wird, wirkt aber
zu 85-90% über die Blockade des Dopamintransporters, wodurch der
Botenstoff länger im Spalt verbleibt und wirken kann.
Erst jüngst haben die Studien von Gunther Moll und Kollegen am
Göttinger Universitätsklinikum Hinweise darauf erbracht, dass
möglicherweise keine pauschale Untererregung des Nervensystems durch
Dopaminmangel die Hyperkinetische Störung kennzeichnet, sondern vielmehr
eine übermäßige Ausbildung des dopaminergen Systems. (11) Moll und
seine Mitarbeiter interpretieren die erhöhte Anzahl an
Dopamintransportern nicht als Hinweis auf eine unnormal starke
Rücktransportaktivität, sondern nehmen einen natürlichen
Zusammenhang zwischen der Dichte des dopaminergen Systems und der
Häufigkeit der für dieses System notwendigen Transporter an. Ein
solcher Zusammenhang wird durch tierexperimentelle Befunde gestützt, bei
denen - entsprechend der Untersuchungen von Dresel und Kollegen an
Menschen (9) - Ratten Methylphenidat verabreicht wurde. Allerdings
unterschieden die Wissenschaftler der Göttinger Forschergruppe zwischen
kindlichen, pubertären und erwachsenen Tieren, denen sie zu
unterschiedlichen Zeiten das Medikament verabreichten. Dabei beobachteten
sie, dass allein die Medikamenteneinnahme im "Kindesalter" zu
einer bleibenden Verringerung der Dopamintransporter führte, während die
Effekte der medikamentösen Behandlung nach der Geschlechtsreife
der Tiere mit Absetzen des Methylphenidats verschwanden. Da die Dichte des
dopaminergen Systems bis zum Jugendalter im Rahmen der Hirnentwicklung
zunimmt, sich dann aber wieder verringert, schlossen Moll und Kollegen aus
ihren Beobachtungen, dass die Behandlung der kindlichen Tiere die
übermäßige Ausbildung des dopaminergen Systems behinderte. Die
geringere Dichte bedurfte schließlich nurmehr einer dauerhaft kleineren
Zahl an Transportern. Demnach würde die erhöhte Anzahl an
Dopamintransportern beim Vorliegen einer Hyperkinetischen Störung weniger
auf einen Mangel als vielmehr auf einen Dopaminüberschuss zumindest
in einzelnen Bereichen des Gehirns hinweisen.
Über die Interpretation der Göttinger Befunde ist seit 2001 heftig
gestritten worden. Die pauschale Kritik, die zunächst v.a. an der kleinen
Zahl untersuchter Tiere geübt wurde, wird der Untersuchung jedoch nicht
gerecht, zumal sich bei weiteren Studien in Göttingen und anderen Labors
eine Bestätigung der Ergebnisse abzeichnet. Insbesondere ein Vertreter
der Göttinger Forschergruppe, der Neurobiologe Gerald Huether, hat nach
Veröffentlichung der ersten Befunde mit klinisch überzogenen Aussagen
Furore gemacht, indem er vor einer Parkinsongefahr bei mit
Methylphenidat behandelten Kindern warnte, deren dopaminerges System sich
unter Medikation möglicherweise nicht genügend ausbilden würde. (12)
Während dieses Risiko gegenüber den aktuellen, nicht selten
existenziellen Problemen hyperaktiver Kinder jedoch eher akademischer
Natur ist, da für die Erkrankung am Morbus Parkinson weitere Faktoren
eine Rolle spielen, wirft die Dopaminüberschusshypothese neue Fragen auf.
Diese Fragen betreffen nicht zuletzt wiederum die Wirksamkeit der
medikamentösen Behandlung, die ja vorderhand das im Spalt zwischen
bestimmten Nervenzellen verfügbare Dopamin durch die Psychostimulanzien
weiter vermehrt wird, obwohl bereits eine übermäßige Ausbildung des
dopaminergen Systems gegeben ist.
Eine eindeutig zu beweisende Antwort darauf steht noch aus. Im Rahmen
des derzeitigen Wissensstandes scheint es jedoch denkbar, dass eine generelle
Übererregung einzelner Hirnareale die hohe Ablenkbarkeit hyperkinetischer
Menschen bedingt, während die Dauererregung zugleich die Aktivierung
hemmender Strukturen wie der Exekutiven Funktionen im Frontalkortex
blockiert. Die Wirkung der stimulierenden Medikamente würde in diesem
Fall durch das Überschreiten eines Schwellenwertes erreicht, wodurch es
auf der Basis des Dopaminüberschusses zu einem vollständigen Verbrauch
bzw. der Auflösung des Dopamins im Spalt kommen würde. Da gleichzeitig
der Rücktransport des Dopamins durch die Blockierung der
Dopamintransporter verhindert ist, muss erst wieder neues Dopamin gebildet
werden, um das frühere (störungsspezifisch überhöhte) Erregungsniveau
wiederherzustellen. Dieser Vorgang dauert ungefähr so lange wie die
Wirkdauer des Methylphenidats angegeben wird: 2 bis 4 Stunden.
|
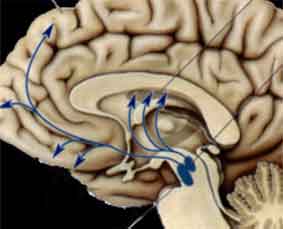
Erst in den letzten zehn Jahren ist es den
Hirnforschern und Entwicklungspsychologen vor allem mit Hilfe der
sogenannten bildgebenden Verfahren gelungen nachzuweisen, welch
nachhaltigen Einfluss frühe Bindungserfahrungen darauf haben, wie und
wofür ein Kind sein Gehirn benutzt, welche Verschaltungen zwischen den
Milliarden Nervenzellen deshalb besonders gut gebahnt und stabilisiert und
welche nur unzureichend entwickelt und ausgeformt werden. Dieses Wissen
beginnt erst jetzt allmählich unter Kinderärzten, Psychiatern und
Erziehern Verbreitung zu finden. Bis es in alle Schichten der Bevölkerung
und zu allen Eltern vorgedrungen ist, werden wohl noch ein paar Jahre
vergehen.
Nicht viel anders verhält es sich mit der zweiten
wichtigen Erkenntnis, dass die frühkindlichen Bindungen nur der erste
Schritt eines langen und komplizierten Sozialisationsprozesses sind. Im
verlauf dieses Prozesses lernt jedes Kind, sein Gehirn auf eine bestimmte
Weise zu benutzen. Beispielsweise indem es dazu angehalten, ermutigt oder
auch gezwungen wird, bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten stärker zu
entwickeln als andere, auf bestimmte Dinge stärker zu achten als auf
andere, bestimmte Gefühle her zuzulassen als andere. Kinder, die in
unterschiedlichen Kulturen aufwachsen, erwerben dabei z.T. sehr
unterschiedliche kulturell tradierte Fähigkeiten. Die Kinder der
eingeborenen des amazonischen Regenwaldes lernen auf diese Weise bis zu
einhundert verschiedene Grüntöne zu unterscheiden und die der Inuit im
nördlichen Polarkreis ein Dutzend verschiedene Formen von Schnee
auseinanderzuhalten. Auch unsere Kinder erwerben im Verlauf dieses
Prozesses all jene Fähigkeiten und Fertigkeiten, auf die es eben für das
Leben in unserem Kulturkreis ganz besonders ankommt. Dadurch werden auch
die dabei immer wieder aktivierten neuronalen Verschaltungen stärker und
intensiver benutzt, ausgebaut und entwickelt.
Gerald Hüther &
Helmut Bonney
Neues vom Zappelphilipp
Walter (2002) S.43f.
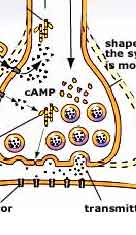
|
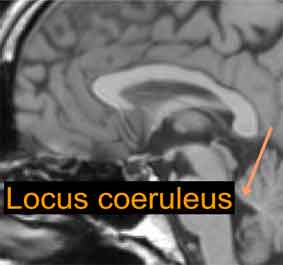
Es erstaunt, welch skurrile und vor allem einen
Wirknachweis schuldig bleibende Verfahren zum Einsatz kommen und Eltern
sehr viel Geld aus der Brieftasche locken, wie zum Beispiel Bachblüten,
Edu-Kinesiologie, verschiedene Eliminationsdiäten, Horchtherapien,
Blicktherapien und Übungsprogramme wie mit dem »Brain-Boy«. Allen
diesen Verfahren ist gemeinsam, dass sie dem Wunschdenken vieler Menschen
entsprechen, dass alles ganz einfach ist und dass man nur das Richtige
üben muss. Erfahrungsgemäß ist jedoch die Biologie eine sehr komplexe
und komplizierte Materie.
Götz-Erik Trott
Pillen für den Zappelphilipp? Medikation - Ritalin und andere
Medikamente
In: ADS: verstehen - akzeptieren - helfen (vgl. 14 S.271f.) |
Ein weiterer Neurotransmitter, der unter
Medizinern im Verdacht steht, an der Symptomatik der Hyperkinetischen
Störung beteiligt zu sein, ist das Noradrenalin, auch Norepinephrin
genannt. Es ist wie das Dopamin ein Catecholamin, d.h. ein Produkt der
Biosynthese aus dem natürlichen Amin Tyrosin. Die noradrenerge Aktivität
im Gehirn geht vom Locus coeruleus aus, einer grau pigmentierten
Zellgruppe im Boden des IV. Ventrikels. Das noradrenerge System wirkt wie
das dopaminerge System v.a. aktivierend (steigert u.a. den Puls), jedoch
z.T. in anderen Regionen der Großhirnrinde sowie des Kleinhirns. Die Befunde zur Bedeutung des Noradrenalins in der Verursachung der
Hyperkinetischen Störung lassen noch keine eindeutige Funktion dieses
Botenstoffs erkennen. Aufmerksam wurde die Medizin auf das Noradrenalin,
weil die Behandlung von hyperkinetischen Patienten mit Antidepressiva
bisweilen Erfolge zeigte. Zum Einsatz kamen dabei
Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (Reboxetin - Markenname ® Edronax),
Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (Venlafaxin - Markenname
® Trevilor) sowie Medikamente, welche die Monoaminooxidase, einen
Catecholaminabbauprozess, verhindern (u.a. Moclobemid - Markenname ®
Aurorix). Keiner dieser Wirkstoffe hat sich jedoch als nur
näherungsweise so effektiv in der Behandlung des Hyperkinetischen
Syndroms erwiesen wie Methylphenidat. (13) Dass die Beeinflussung
des noradrenergen Systems derzeit so stark diskutiert wird, hängt weniger
mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammen als vielmehr mit dem
gesellschaftspolitischen Interesse, das der medikamentösen Behandlung
von hyperkinetischen Kindern derzeit entgegengebracht wird. Hierbei geht
es vor allem um den Einsatz des Amphetaminderivats Methylphenidat (®
Ritalin bzw. ® Medikinet), dem v.a. in der Boulevardpresse trotz
gegenteiliger Forschungslage ein Suchtpotential unterstellt wird. (14)
Manche Pharmafirmen, aber v.a. viele pseudotherapeutische Schulen und
Sektenunternehmen versuchen, aus der Diskussion Kapital zu schlagen und
meist in ihrer Wirksamkeit zweifelhafte oder gar schädliche
"Naturheilmittel" und Psychotechniken als geeignete Therapien zu
verkaufen. Ob die insbesondere vom Pharmakonzern Lilly betriebene
Konzentration auf das noradrenerge System mit der intensiven
Neuvermarktung einer bereits seit Jahren bekannten Substanz (Atomoxetin -
Markenname ® Tomoxetin) tatsächlich einen bedeutenden neuen Bereich der
wissenschaftlichen Betrachtung und medikamentösen Therapie der
Hyperkinetischen Störung erschließen wird, ist allerdings fraglich. (15) |
|
Immunsystem und komorbide Störungen
|

Bei einem Vortrag des Kinderschutzbundes höre ich
von der referierenden Ärztin zum ersten Mal etwas von der
Phosphatempfindlichkeit und dem Verhalten dieser Kinder. Ich gehe mit
beiden Buben zu dieser Ärztin, und wir beginnen mit der Umstellung der
Ernährung. [...] Wir leben alle mit der Ernährungsumstellung, zunächst
ohne Erfolg. Nach einem Vierteljahr tritt bei E. eine Besserung ein, er
wird etwas ruhiger, die Schrift wird besser, er liest sogar über einen
längeren Zeitraum hinweg ein Buch. Etwa ein halbes Jahr nach der
Einführung der phosphatarmen Ernährung zeigen sich auch bei S. erste
Erfolge, die Schulleistungen werden sehr viel besser. Ein Lehrer sagt zu
ihm: »Sind Sie ein fauler Hund gewesen!« Unsere Nahrungspalette ist
inzwischen extrem eingeschränkt, wir müssen zusätzlich Vitamine,
Kalzium etc. einnehmen. Einige Verhaltensauffälligkeiten bleiben dennoch
unverändert: Impulsivität, Verständnis- und Wahrnehmungs-
schwierigkeiten bleiben bestehen, aber außer in Streßsituationen sind
sie deutlich ruhiger geworden.
Johanna Krause
Leben mit hyperaktiven Kindern.
Piper/C&H (1995) S.94f.
(aus dem Kapitel:
Werdegang dreier hyperaktiver Kinder) |
Über viele Jahre standen Reaktionen des
Immunsystems im Verdacht, die Hyperkinetische Störung auszulösen.
Vorreiter dieser Bewegung war der amerikanische Arzt und Allergologe Benjamin
Feingold, der in den 1970er Jahren mit Veröffentlichungen über eine
spezielle Diät, die Feingold-Diät, berühmt wurde. 1976 wurde die
Feingold Association of the United States (FAUS) gegründet, die
bis heute Tausende von Mitgliedern, v.a. Familien mit hyperaktiven
Kindern, repräsentiert. Der zunächst erhobene Anspruch, die
Hyperkinetische Störung allein durch allergische Immunreaktionen auf
bestimmte Nahrungsmittel und Ergänzungsstoffe (u.a. Phosphate) erklären
und mit dem Verzicht auf solche Nahrungsbestandteile behandeln zu können,
wurde in späteren Jahren jedoch aufgegeben. 1980 wurde in Deutschland die
Phosphatliga gegründet, die zunächst primär den Ideen Feingolds
verpflichtet war. Bereits 1987 erfolgte jedoch die Umbenennung in Arbeitskreis
Überaktives Kind (AÜK), da man rasch erkannte, dass die
Phosphat-Theorie zu kurz griff und eine Diät nur bei einem Teil der
entsprechend ernährten Kinder eine Symptomverringerung brachte.
Nichtsdestotrotz werden Ernährungseinflüsse auf die Symptomatik der
Hyperkinetischen Störung noch immer diskutiert und Diäten v.a. in
populären Erziehungsratgebern zum Thema angepriesen. (16)
Obwohl die Symptome der Hyperkinetischen Störung, insbesondere die
Hyperaktivität, durchaus Ähnlichkeit mit Verhaltensweisen bei
allergischen Reaktionen haben, konnte bislang ein systematischer
Zusammenhang der Verhaltensstörung mit Allergien oder der
Unverträglichkeit bestimmter Nahrungsmittel nicht nachgewiesen werden. Da
in den letzten Jahren (auto-)immunologische Vorgänge im menschlichen
Körper als Faktoren bei der Entstehung von Zwangs- und Ticstörungen
identifiziert wurden, ist es allerdings nicht gänzlich auszuschließen,
dass in den nächsten Jahren auch im Fall der Hyperkinetischen Störung
Infekte bzw. durch diese provozierte Immunreaktionen als Faktoren
ermittelt werden. Es erscheint jedoch auch für die Zukunft
unwahrscheinlich, dass einzelne Ursachen für das vielschichtige
Störungsbild zu finden sind. Eine durch spezielle Antikörper (IgE)
vermittelte hyperkinetische Symptomatik, wie sie im Fall von atopischen
Erkrankungen der Haut (z.B. Neurodermitis) bzw. Schleimhaut denkbar wäre,
ist bisher nicht beobachtet worden.
Insgesamt sind komorbide, d.h. überzufällig gemeinsam auftretende
kinder- und jugendpsychiatrische Störungen zwar ein Hinweis auf mögliche
gemeinsame Ursachen. Komorbidität allein begründet jedoch noch keinen
kausalen Zusammenhang zwischen einzelnen Störungen, zumal gerade
unter dem Aspekt einer gestörten Entwicklung genetische, physiologische
und psychische Faktoren nicht isoliert zu betrachten sind. So wird bei
rund 60% aller Kinder, die an einer multiplen Tic-Störung (Tourette-Syndrom)
leiden, zugleich eine Hyperkinetische Störung diagnostiziert. Allerdings
sind für das Auftreten einer hyperkinetischen Symptomatik vor den
Symptomen der Tic-Störung eigenständige Ursachen anzunehmen, während
die Ausbildung hyperkinetischer Verhaltensweisen nach dem Auftreten
der Tic-Störung meist als Teil des Tourette-Syndroms zu erklären ist.
Gleichermaßen ergibt sich aus dem häufig gemeinsamen Auftreten von
Hyperkinetischem Syndrom und Teilleistungsstörungen
bei rund 20-30% der hyperkinetischen Kinder kein ursächlicher
Zusammenhang der Störungen. (17) Weder störungsübergreifende genetische
Anlagen noch vermeintliche psychische Wechselwirkungen sind aus den heute
vorliegenden klinischen Befunden eindeutig abzuleiten. Handelt es sich
bei der Behinderung im Lern- und Leistungsvermögen nicht nur um eine
soziale Folge der verminderten Aufmerksamkeit sowie des gestörten
Verhaltens, sondern um ausgeprägte Defizite in einem bestimmten Bereich
der intellektuellen Begabung, so liegt vermutlich eine eigenständige
Störung vor. Wie jemand, der einen Schnupfen hat, sich auf dem Weg zur
Apotheke ein Bein brechen kann, so kann die Hyperkinetische Störung mit
einer Vielzahl an psychischen und auch körperlichen Auffälligkeiten
einhergehen bzw. deren Auftreten sogar begünstigen, ohne dass aus diesem
Grund eine gemeinsame Ursache anzunehmen ist. |
Gifte und andere Schädigungen des Gehirns
|
|
| In rund 20 Prozent der Fälle, bei
welchen Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen eine Hyperkinetische
Störung diagnostiziert wird, ist unklar, welche Ursachen die
beobachtete Symptomatik hat. Das heißt nicht, dass wir in jedem
Einzelfall der verbleibenden ca. 80 Prozent genau wissen, was die
Störung wie auslöst oder begünstigt. Allerdings ergibt sich für
diese große Mehrheit an Betroffenen und ihre Krankengeschichte ein klares
Bild: Die Symptome sind eindeutig und treten in typischer Einheit
miteinander auf; die Vorgeschichte der Störung lässt ein durchgängiges
Muster an Auffälligkeiten (z.B. motorische Unruhe) erkennen, das eine
diesbezügliche biologische Anlage vermuten lässt; Eltern und/oder
Geschwister der Patienten zeigen vergleichbare Verhaltensauffälligkeiten;
und - jedoch nicht als Diagnosekriterium zu verstehen - die Behandlung mit
den heute gebräuchlichen stimulierenden Medikamenten ist fast immer
wirkungsvoll. Demgegenüber lassen sich die genannten 20 Prozent an
Betroffenen, denen ebenfalls eine Hyperkinetische Störung attestiert
wurde, nicht so einfach hinsichtlich Symptomatik und Verlauf
zusammenfassen. Dies lässt vermuten, dass deren besondere
Auffälligkeiten zumindest teilweise auf andere Ursachen als eine
angeborene und durch die Sozialisation ausgeprägte abweichende
neurobiologische Anlage zurückzuführen sind. Welche Ursachen sind
hierbei denkbar?
Zum einen Intoxikationen, d.h. Vergiftungen durch Substanzen,
die dem Körper von außen zugeführt oder von ihm selbst in schädlicher
Konzentration hergestellt werden. Als Intoxikation bezeichnet man dabei
nicht nur lebensbedrohliche Vergiftungen, sondern jede schädliche Wirkung
von Substanzen auf einen Organismus, also beispielsweise auch die
schleichende Gesundheitsbeeinträchtigung durch Schadstoffe in der Luft.
Insofern besteht eine fließende Grenze zwischen Intoxikationen und
Allergien: Während die Intoxikation das Übermaß einer Substanz an einer
bestimmten Stelle des Organismus voraussetzt, wird die Allergie durch eine
Überempfindlichkeit des Organismus bedingt, der bereits alltägliche
Konzentrationen einer Substanz (z.B. Pollen verschiedener Gewächse) nicht
mehr ohne Beeinträchtigung seiner normalen Funktion toleriert.
Obgleich für die Hyperkinetische Störung bislang keine allergischen
Reaktionen als Ursache oder auch nur Teilfaktor der Symptomatik
nachgewiesen werden konnten, weiß man, dass einige Substanzen in
überhöhter Konzentration insbesondere hyperaktives Verhalten auslösen
können. Dazu zählen u.a. Blei, Kupfer (auch in Verbindung
mit einer Schilddrüsenüberfunktion) und andere Schwermetalle, aber auch Alltagsdrogen
wie Coffein. Je nach der körperlichen Verfassung eines Menschen sowie
in Wechselwirkung mit anderen Substanzen kann eine Vielzahl weiterer
Wirkstoffe hyperkinetische Symptome hervorrufen, deren Grund jeweils
individuell abgeklärt werden muss, wenn eine betroffene Person in einer
entsprechend belasteten Umwelt lebt bzw. einschlägige Substanzen in
unüblicher Menge konsumiert. Des weiteren können auch körpereigene
Substanzen wie beispielsweise Schilddrüsenhormone Hyperaktivität
auslösen; die Bestimmung der verschiedenen Thyroxin-Parameter zum
Ausschluss einer Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) gehört
daher zur Basisdiagnostik beim Verdacht auf das Vorliegen einer
Hyperkinetischen Störung.
Allerdings sind die wechselseitigen Bedingungen von physiologischer
Disposition und Umwelteinwirkungen so vielschichtig, dass die oft
zahlreichen Faktoren bereits eines einzelnen Symptoms nur schwer zu
isolieren und zu messen sind. Solange die klinische Symptomatik von
auffällig unaufmerksamen, unruhigen und impulsiven Menschen nicht
nachweislich auf die Intoxikation durch einzelne Substanzen
zurückzuführen ist, muss die Diagnose einer Hyperkinetischen Störung
auch dann als berechtigt gelten, wenn das Krankheitsbild und die
Krankengeschichte weitere Ursachen zwar nahelegen, die in Frage stehenden
Faktoren die Krankheit jedoch weder schlüssig noch ausschließlich
erklären können.
|
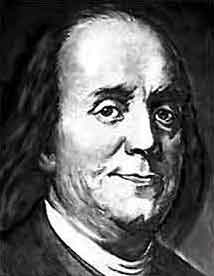
In
America I have often observed that on the Roofs of our shingled Houses
where Moss is apt to grow in northern Exposures, if there be any thing on
the Roof painted with white lead, such as Balusters, or Frames of dormant
Windows, &c. there is constantly a streak on the Shingles from such
Paint down to the Eaves, on which no Moss will grow, but the Wood remains
constantly clean & free from it.--We seldom drink Rain Water that
falls on our Houses; and if we did, perhaps the small Quantity of Lead
descending from such Paint, might not be sufficient to produce any
sensible ill Effect on our Bodies. But I have of a Case in Europe, I
forgot the Place, where a whole Family was afflicted with what we call the
Dry-Bellyach, or Colica Pictonum, by drinking Rain Water. It was at a
Country Seat, which being situated too high to have the Advantage of a
Well, was supply'd with Water from a Tank which receiv'd the Water from
the leaded Roofs. This had been drank several Years without Mischief; but
some young Trees planted near the House, growing up above the Roof, and
shedding their Leaves upon it, it was suppos'd that an Acid in those
Leaves had corroded the Lead they cover'd, and furnish'd the Water of that
Year with its baneful Particles & Qualities.
Benjamin
Franklin
Brief an Benjamin Vaughan (1786), zitiert nach einer Kopie in der
US Library of Congress |

So hatte ich mich in Michels Alter vor dem Kindergarten von der Hand
meiner Erzieherin losgerissen und vollbrachte am Kotflügel eines
vorbeifahrenden Autos einige artistische Übungen. Daraufhin landete ich
mit einem doppelten Salto ohne Netz und keiner weiteren Sicherung als der
Krankenversicherung meiner Eltern auf der Chirurgie unseres
Provinzhospitals. Da mein Großvater dort früher Chefarzt, meine Mutter
Ärztin gewesen war, nahm man sich meiner äußerst zuvorkommend an. Meine
Eltern waren zu dieser Zeit im Urlaub und unerreichbar. Zurück in der
Heimat schenkten sie dem kleinen Patienten ein Postauto, das
batteriegetrieben eine Runde auf dem Krankenhausfußboden drehte, wenn man
oben zehn Pfennig einwarf. Da ich viel Besuch bekam und sehr eindringlich
betteln konnte, verließ ich das Spital als reicher Mann.
Johannes
Streif
Michel aus Lönneberga - Kind hoch drei
In: Ein Herz und eine Serie. Hrsg. von Bettina Brömme
& Thomas Endl
Reclam Leipzig (1999) S.138 |
Ein weiteres graues Feld möglicher Ursachen der Hyperkinetischen Störung
jenseits der vererbten und durch die individuelle Entwicklung
beeinflussten neurobiologischen Disposition sind Schädigungen des
Gehirns. Solche sogenannten Läsionen können vielgestaltiger Natur
sein und ihrerseits verschiedene Ursachen haben. Bei Auffälligkeiten in
zentral vom Gehirn gesteuerten Funktionen, zu denen psychiatrische und
neurologische Erkrankungen sowie Verhaltensstörungen zählen, ist die
gängigste Annahme eine prä- oder perinatale Schädigung von
Hirnstrukturen. Pränatale Schädigungen sind Fehlentwicklungen
oder Zerstörungen von Bereichen des Gehirns vor der Geburt. Sie
können einerseits durch Substanzen verursacht werden, welche die Mutter
als Nahrung oder durch Atmung und Haut zu sich nimmt, andererseits aber
auch durch den Mangel an lebensnotwendigen Grundstoffen. In diesem Sinne
erhöht das Rauchen bzw. Passivrauchen von Müttern die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind an der Hyperkinetischen Störung leidet,
wobei möglicherweise in vielen Fällen sowohl die mütterliche
Nikotinabhängigkeit als auch die kindliche Verhaltensstörung auf einer
genetisch vermittelten gemeinsamen Disposition beruhen. (18) Denkbar sind
aber auch pränatale Schädigungen durch physische Einwirkungen, bei denen
unfall- oder gewaltbedingt der Fötus im Mutterleib verletzt wird. Perinatale
Schädigungen sind hingegen Zerstörungen der Hirnstruktur, die im
zeitlichen Umfeld der Geburt des Kindes entstehen. Sie werden meist durch
Sauerstoffmangel oder physische Einwirkungen während der Geburt
verursacht. Sowohl vor- als auch frühe nachgeburtliche Schädigungen des
Gehirns sind nicht selten unspezifischer Art, d.h. sie sind nicht immer
mit bildgebenden Verfahren eindeutig zu erfassen und in ihren Konsequenzen
für die Entwicklung und das Verhalten des Kindes beschreibbar. Die Idee
der prä- oder perinatalen Schädigung des Gehirns bestimmte das frühere
Konzept des Minimale Brain Damage bzw. der Minimalen Cerebralen
Dysfunktion (vgl. Namen der Störung).
Natürlich kann es auch im späteren Leben zu Schädigungen
an Hirnstrukturen kommen. Diese geschehen häufig durch Unfälle, die
umschriebene Bereiche des Gehirns betreffen. Solche durch physische
Einwirkungen verursachten Läsionen sowie ihre Konsequenzen zog bereits
1902 der englische Arzt George F. Still zur Charakterisierung der
Symptomatik der späteren Hyperkinetischen Störung heran (s.o.).
Betroffen vom sogenannten "Frontalhirnsyndrom" sind
Menschen, deren Großhirnrinde im Bereich der Stirn verletzt wurde, jener
Stelle also, an der die Exekutiven Funktionen angesiedelt sind. Neben den
unmittelbaren Unfallfolgen gibt es freilich noch eine große Anzahl
weiterer Gründe für bleibende Hirnschädigungen, die von den bereits
angeführten Substanzeinwirkungen (Gifte, Drogen) über Mangel-
und Stoffwechselerkrankungen bis hin zu erblichen degenerativen,
d.h. die Struktur des Gehirns auflösenden Neuropathien reichen. Viele
dieser Leiden sind sehr selten, weshalb eine umfangreiche Diagnostik nur
dann angezeigt ist, wenn entsprechende Beeinträchtigungen durch
spezifische Lebensbedingungen oder Häufungen im Familienkreis nahe
liegen. Treten die Symptome einer Hyperkinetischen Störung jedoch erst im
Erwachsenenalter auf, so macht es Sinn, zunächst krankhaften
Veränderungen im Gehirn nachzugehen, bevor eine retrospektive Diagnose
von hyperkinetischen Auffälligkeiten oder gar eine vorschnelle Therapie
versucht wird.
Dennoch. Wie im Fall der komorbiden Störungen bereits festgestellt, so
gilt auch hier, dass die Hyperkinetische Störung für die Mehrzahl der
Schädigungen des Gehirns weder ein begünstigender Faktor noch ein
Ausschlusskriterium ist. Hyperkinetiker können wie anderen Menschen auch
an den neurologischen Folgen von Stoffwechselstörungen, von
Unfallschäden oder beispielsweise auch von Hirntumoren leiden. Für die
Hyperkinetische Störung spricht eine weitgehende Konstanz der
Symptomatik über das gesamte Leben hinweg, wenngleich die
unterschiedlichen Lebenssituationen von Kindern und Erwachsenen das
gleiche Symptom häufig in unterschiedlichem Licht erscheinen lassen.
Gegen eine Hyperkinetische Störung und für pathologische Veränderungen
im Organismus spricht demgegenüber eine rasch und unvermittelt sich
darstellende Symptomatik - auch und gerade dann, wenn die Psyche des
Betroffenen, wenn Emotionen und Verhalten sich überraschend ändern. Dann
ist eine Differentialdiagnostik nicht nur sinnvoll, sondern gegebenenfalls
lebensrettend.
|
|
Erziehung und Sozialisation
|
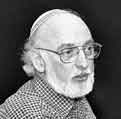
John M. Gottman
u.a. auf Deutsch:
Kinder brauchen emotionale Intelligenz
Heyne (1998)

Väter und Mütter von
hyperkinetischen Kindern vereinen in ihrer Erziehungshaltung zudem
gleichermaßen Elemente des Coaching, des Gewährenlassens und der Missbilligung,
wohingegen die Eltern der diesbezüglich unauffälligen Kinder
Nichtbeachtung und Missbilligung mit geringer Toleranz des in Frage
stehenden Verhaltens verbinden. Vorderhand mag dies auf eine geringere
erzieherische Eindeutigkeit oder Konsequenz der Eltern von ADHD-Kindern
schließen lassen. Allerdings begegnen sie dem Ärger ihrer Kinder nicht
weniger coachend als die Eltern der Vergleichspopulation; vielleicht
versuchen sie angesichts der geringeren Selbstregulations-
kompetenzen ihrer hyperkinetischen Söhne, die Eskalation des Ärgers
durch gelegentliche Duldung problematischen Emotionsausdrucks zu
vermeiden. Dem entspricht auch die tendenzielle Differenzierung zwischen
hyperaktiven und nicht hyperaktiven Kindern innerhalb der Population der
vorliegenden Untersuchung. Hier ergeben sich geringere Laisser-faire- und
größere Nichtbeachtung / Missbilligung-Werte für die hyperaktiven,
jedoch größere Laisser-faire-
und geringere Nichtbeachtung / Missbilligung-Werte für die nicht
hyperaktiven Kinder.
Johannes
Streif
Meta-Emotion: Emotionale Kommunikation in Familien mit hyperkinetischen
Kindern. Diplomarbeit
München (1999) S.167f.
|
Gleich vorweg: Das, was Psychologie und
Psychiatrie heute als die Hyperkinetische Störung bezeichnen, kann nicht
durch Erziehung oder anderweitige Umweltprägung hervorgerufen
werden! Kritiker der Diagnose sind bis heute jeden Beweis dafür schuldig
geblieben, wie sie das systematische Auftreten der spezifischen
Verhaltensauffälligkeit durch die unterschiedlichsten Umweltbedingungen
erklären können, ohne eine genuine, den Betroffenen innewohnende gleiche
Ursache zu akzeptieren. Angesichts der vielfältigen Formen menschlicher
Gemeinschaften auf dieser Erde grenzt es ohnehin an ein Wunder, dass wir
über die Menschheit hinweg so viele Verhaltensweisen teilen, uns im
Denken und Fühlen des anderen so sehr wiederfinden können. Das
abendländische Mittelalter sah in dieser moralischen Universalität sogar
einen Gottesbeweis, als ob nur der Schöpfer die grundsätzliche Haltung
zum Leben allen Menschen gleich habe eingeben können. Aber sollten wir
auch nur an einen Sieg der menschlichen Vernunft glauben, so ist es
dennoch wunderbar, dass weite Teile der heutigen Menschheit eine
gemeinsame Vorstellung vom Menschenrecht haben und sich gleichermaßen
gesellschaftlichen Regeln verpflichtet fühlen. Und ausgerechnet die Welt
der hyperkinetischen Kinder soll nun eine sein, die diese Kinder nicht
oder nicht hinreichend auf eine Gemeinschaft und ihre Regeln vorbereitet? Der amerikanische Psychologe und Wissenschaftler
John Gottman, der v.a.
durch seine Forschungen zu Partnerschaft und Familie bekannt wurde, hat in
einer aufwendigen Studie 53 Familien mit einem zu Beginn der Untersuchung
4 bis 5 Jahre alten Kind über mehrere Jahre hinweg begleitet. Dabei
erfasste er neben einer Vielzahl an psychologischen und soziologischen Daten
insbesondere den emotionalen Umgang der Familienmitglieder miteinander. In
einem eigens entwickelten Interview befragte er Eltern und Kinder, wie sie
mit dem Erleben von Ärger und Traurigkeit an sich selbst sowie an anderen
umgehen. 1997 veröffentlichten er und seine Mitarbeiter schließlich die
Ergebnisse der Untersuchung in einem umfangreichen wissenschaftlichen
Buch. (19)
Gottman und seine Kollegen fanden heraus, dass die Aufmerksamkeit sowie
das strukturierte Eingehen auf die emotionale Verfassung des Kindes einen
erheblichen Einfluss auf seine Entwicklung hat. Im Mittel waren die Kinder
von emotional zugewandten Eltern, die Ärger und Traurigkeit der Söhne
und Töchter sahen, ohne jedoch jede Form der Gefühlsäußerung zu
dulden, nach drei Jahren nicht nur emotional reifer und sozial
kompetenter, sondern auch intelligenter. Darüber hinaus zeigte eine Reihe
von physiologischen Parametern, u.a. EKG*-Messwerte und Laborwerte von
Stresshormonen**, dass sich die Kinder in emotional strukturierten
Familien auch in ihrer biologischen Verfassung anders entwickelt hatten.
Ein Erziehungsstil, der nach der amerikanischen Psychologin Diana Baumrind
(20) autoritativ genannt wird und - einfach gesagt - spürbare elterliche
Liebe mit erzieherischer Konsequenz verbindet, begünstigte offenbar die
Ausbildung der physiologischen Voraussetzungen zur Selbstregulation: eine
maximale Steuerung der parasympathischen Aktivität. Das parasympathische
Nervensystem erfüllt auf der Seite des vegetativen Nervensystems
(Organsteuerung, u.a. Augen, Herz, Lunge) ähnliche die Erregung hemmende
Aufgaben wie die frontalen Bereiche der Großhirnrinde auf Seiten der
willentlichen Verhaltenskontrolle (die sogenannten Exekutiven
Funktionen, s.o.).
Die Erziehung hatte also nicht nur einen psychologisch und sozial auch von
Außenstehenden (z.B. Lehrern) beobachteten Einfluss auf die Entwicklung
der Kinder, sondern sogar einen Effekt auf die körperliche Verfassung und
die physiologischen Voraussetzungen zur Selbstregulation. [*
Elektrokardiogramm zur Messung der Herzfunktion; ** hier im Urin bestimmte
Catecholamine: Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin, Cortisol]
Warum wird dies hier so ausführlich dargestellt? Erstens, weil es zur
Studie von Gottman und seinen Mitarbeitern bisher in Ansatz und Umfang
keine vergleichbare Untersuchung gibt. (21) Zweitens, weil Gottman und
Kollegen eine Ausnahme in dieser und anderen ihrer Untersuchungen
beschreiben: Kinder, die an einer Hyperkinetischen Störung leiden. Obwohl
diese Kinder unter vergleichbar günstigen Sozialisationsbedingungen
ebenfalls einen guten und im Vergleich mit nicht-hyperkinetischen Kindern
unauffälligen Steuerungsspielraum der parasympathischen Aktivität
ausbilden, erreichen sie dennoch nicht das gleiche Maß an
Aufmerksamkeitssteuerung und Selbstregulation. (22) Entsprechende Befunde
ergaben sich bereits in früheren Studien anderer Wissenschaftler und
stützen die Annahme einer spezifischen Entwicklungsverzögerung und auch
Entwicklungsabweichung, wie sie in diesem Artikel an anderer Stelle
bereits beschrieben wurden. (23) Damit ist keinesfalls bewiesen, dass
Erziehung - wie auch andere Umwelteinflüsse - bei hyperkinetischen
Kindern wirkungslos ist. Sie hat allerdings bei gleicher Absicht und
Hingabe der Erziehenden nicht immer die gleiche Wirkung. Vielleicht sollte man die
Hyperkinetische Störung daher weniger nach ihren unmittelbaren
Verhaltenseffekten charakterisieren als vielmehr nach dem, was sie an
normaler Entwicklung behindert. In diesem Zusammenhang bekommen die
vielfältigen Einflüsse der unterschiedlichen Gesellschaften auf dieser
Erde, in denen
stets auch betroffene hyperkinetische Menschen leben, im Spiegel der Störung ein
gemeinsames Gesicht: der erziehungs- und sozialisationsunabhängigen
Schwierigkeit, sich selbstgesteuert an die Regeln einer Gemeinschaft
anzupassen. Egal, wie diese Regeln aussehen und wer sie vermittelt.
|
| Diese Sichtweise offenbart auch,
wie unsinnig der Schluss ist, dass der Grund gleicher Verhaltensweisen
stets derselbe sein muss - oder verschiedene Verhaltensweisen nicht auch
denselben Grund haben können. Nimmt man an, dass ein erheblicher Teil der
physiologischen Grundausstattung des Menschen im Sinne seines Temperaments
angeboren ist, so bleibt für die Entwicklung nur ein
eingeschränkter Spielraum. Hinzu kommt, dass die an die Bedingungen der
Situation angepassten Verhaltensweisen zunehmen, je mehr der Mensch in
der Lage ist, entsprechende "Zeichen" der Umwelt zu sehen, zu
verstehen und auf sie selbstgesteuert zu reagieren. Dennoch kann das eine
nicht unabhängig vom anderen betrachtet und erklärt werden. Es ist
müßig zu fragen, wieviel Natur und wieviel Kultur wir an einem
hyperaktiven Kind sehen, das wagemutig in den Wipfel eines Baumes
klettert. Ohne seine Anlage hätte es vielleicht dem Reiz des
gefährlichen Kletterns widerstanden oder die Warnungen der Eltern
beherzigt; wäre es köperbehindert oder gäbe es in seiner Umwelt keine
Bäume, könnte das Kind nicht klettern. Vor diesem Hintergrund die Verhaltensauffälligkeit
des hyperkinetischen Kindes, die doch nur angesichts des Mittelmaßes
aller Kinder, aller sozialen Entwicklungsverläufe und aller beobachteten
Lebenssituationen erkennbar wird, ausschließlich einzelnen Gründen
der Erziehung oder Sozialisation zuzuschreiben, ist reichlich naiv. Und
wenn ein Kind mit ungünstigem Temperament - unruhig als Baby, laut und
ungestüm als Kleinkind, unaufmerksam als Schüler, impulsiv als
Jugendlicher in seinen Beziehungen - schließlich ohne Ärzte und
Psychologen, ohne Medikamente und Therapien doch ein zufriedener und in
der Gesellschaft anerkannter Erwachsener wird, dann spricht das nicht gegen
die Diagnose einer Hyperkinetischen Störung und auch nicht gegen die
Therapie der Verhaltensauffälligkeit. Es spricht vielmehr für eine
große Leistung seiner Eltern, Geschwister, Lehrer und Freunde, die man
nicht von jeder Mutter und jedem Vater, nicht von allen Geschwistern und
Freunden, nicht von allen Lehrern und Erziehern erwarten kann.
Der Münchner Kinderarzt Walter Eichlseder war einer der ersten
in Deutschland, der sich gegen die Unterstellung verwahrte, elterliche
oder familiäre Disharmonie könnten die Hyperkinetische Störung
hervorbringen. "Man sagt, dass Kinder darunter leiden würden, und
dass sie deshalb verhaltensgestört seien. Das erste ist wahrscheinlich
richtig, das zweite ist eine Behauptung, die noch nie bewiesen worden
ist." (24) Korrelationsstudien, d.h. statistische Berechnungen von
Zusammenhängen zwischen zwei oder mehr Informationen, zeigen immer
wieder, dass verhaltensauffällige Kinder häufiger als unauffällige
Kinder in ungeordneten Familienverhältnissen leben, in Pflegefamilien und
Heimen aufwachsen, ja bereits als Kleinkinder zur Adoption freigegeben
werden. Doch diese Studien können nicht belegen, was die Ursache und
was die Wirkung ist: Waren Eltern und Familie zuerst zerstritten und
versäumten so eine gute Erziehung des Kindes - oder begannen sie ihren
Streit unter der Last der Erziehung eines kaum zu bändigen Kindes? Ist es
denn tatsächlich denkbar, dass die Monate oder wenigen Jahre, die ein
adoptiertes Kind bei seinen leiblichen Eltern oder im Heim verbrachte,
sein Verhalten auf Dauer bestimmen, und zwar ausgerechnet im Sinne der
Symptome einer Hyperkinetischen Störung? Vielleicht gibt es doch diese in
der Natur des Menschen liegende Andersartigkeit in Entwicklung und
Verhalten, die bereits die Eltern der hyperkinetischen Kinder belastet und
- noch unabhängig vom eigenen Kind - Lebensbedingungen schafft, unter
denen Beziehungen schwieriger und Gemeinschaften zerbrechlicher sind.
Ist es denn wirklich ein ungeheuerlicher Schuldspruch anzunehmen, dass
Partnerschaften und Familien, nicht anders als Schulklassen oder Vereine,
am Verhalten eines Kindes scheitern können?! Sie scheitern doch auch an
der Attraktivität neuer Beziehungen, scheitern an finanziellen
Einschränkungen oder Arbeitszeiten. Mit der Überforderung einer
Gemeinschaft durch ein hyperaktives Kind ist kein Urteil über die Schuld
des Kind gesprochen, sondern über die unabwägbaren Vorstellungen, wie
Eltern, Lehrer oder Freunde mit diesem Kind zu leben hofften. An
unseren Erwartungen messen wir uns täglich - und scheitern zwangsläufig
immer wieder, da doch niemand weiß, was die Zukunft bringen wird. Alle
wissenschaftlichen Untersuchungen haben bis heute nichts an der
Unabsehbarkeit zukünftiger Entwicklungen ändern können. Weder
psychologische Bindungstheorie noch soziologische Gesellschaftstheorien
können letztgültig erklären, was Menschen und Gemeinschaften zu dem
macht, was sie sind. (25) Barkley schreibt, erfolgreichen Menschen in der
Gesellschaft stünde Demut an angesichts des Umstandes, dass sie
weder für sich selbst noch ihre Kinder die Natur geschaffen haben, die
eine Voraussetzung des Erfolges ist: eine Physiologie, die gute
Selbstregulation und Begabung miteinander verbindet. (26) Für die blinde
Arroganz, mit der manche Politiker, Gesellschaftskritiker und
selbsternannten Therapeuten auf vermeintlich versagende Eltern, Schulen
und gesellschaftliche Strukturen verweisen, gibt es in dieser komplexen
Welt wenig Rechtfertigung. Für die Behauptung aber, die Hyperkinetische
Störung würde durch Erziehung oder andere Sozialisationseinflüsse
verursacht, gibt es gar keine Rechtfertigung! |

Extrem zappelig. Keine Minute ruhig. Sorgt bei Tisch
nur für Aufregung. Verschüttet regelmäßig etwas. Frisst in sich
hinein. Strahlt Unruhe aus, sobald er den Raum betritt. Zündelt. Wenn er
die Treppe herunterstürzt, ist das nicht nur laut, sondern ungeschlacht
und vehement. Spielt um sechs Uhr früh mit dem Eishockeyschläger im
Treppenhaus mit dem Ball. [...]
Die Mutter meinte, wenn sie ihr Kind nicht so liebte
und nicht wüsste, dass es im Grunde ein lieber Junge sei, der es nicht so
meint, könnte sie das überhaupt nicht mehr aushalten.
Die meisten Mütter betonen, die Geschwister seien
auch einmal lebhaft, wild oder ausgelassen. Aber dieses eine Kind hätte
eine Art und ein Ausmaß an Aktivität in sich, dass es den Rahmen des in
der Familie möglichen sprenge. Es sprengt auch jede Klasse, und es
verwandelt jeden Spielplatz in ein Schlachtfeld.
Walter Eichlseder
Unkonzentriert?
Beltz (1996) S.33f. |
|
Eine kurze Zusammenfassung
|

Aus meinem Modell folgt, dass die Behandlung des
hyperkinetischen Syndroms auch Eltern und Lehrer einbeziehen sollte.
Ergänzend zu einer Therapie der Kinder mit Psychostimulanzien - und in
manchen Fällen mit Antidepressiva - müssten die Erzieher darin geschult werden,
wie sie mit den Verhaltensauffälligkeiten ihrer Zöglinge gezielter und
geschickter umgehen können. Hilfreich ist es beispielsweise, wenn das
Kind auf sein Verhalten hin gleich eine Rückmeldung erhält, also
möglichst oft und schnell die Konsequenzen erfährt, insbesondere auch
Lob und Anerkennung. [...]
Eine wirkliche Heilung für das hyperkinetische
Syndrom gibt es wohl nicht, aber man kennt jetzt immer bessere
Möglichkeiten, mit dieser bleibenden, oft schwerwiegenden
Entwicklungsstörung umzugehen und sie zu meistern. Vielleicht gibt es
schon bald genetische Tests dafür und dann auch Pharmaka, die
hyperaktiven Kindern noch gezielter helfen.
Russel A. Barkley
Hyperaktive Kinder
In: Spektrum der Wissenschaft 3
März 1999 S.35f. |
Die Erforschung der Hyperkinetischen Störung
dauert nun bereits mehr als 100 Jahre an. Die vom englischen Arzt George
F. Still 1902 erstmals umfassend beschriebene Symptomatik sowie seine
Hinweise auf vergleichbare Verhaltensauffälligkeiten bei Patienten mit
spezifischen Hirnschädigungen haben schon damals wesentliche Aspekte der
Störung erfasst. Nach Jahrzehnten der Fokussierung auf Defekte der
Hirnstruktur ermöglichten zu Beginn der 1990er Jahre die modernen
bildgebenden Verfahren erstmals auch die Untersuchung des
Hirnstoffwechsels. Heute ist davon auszugehen, dass die Störung von
Aufmerksamkeit, Aktivität und Impulsivität durch eine Dysregulation des
Dopamin-Stoffwechsels entsteht, die sowohl mittelbare Folgen für die
willentliche Selbststeuerung (sog. Exekutive Funktionen) hat als auch
unmittelbar auf die motorischen Funktionen wirkt. Dabei wird diese Dysregulation
primär genetisch vererbt und nur sekundär durch Umwelteinflüsse
auf die Entwicklung sowie durch momentane, von der augenblicklichen
Situation abhängige Reize bedingt.
Verschiedene in wissenschaftlichen wie populären Foren diskutierte
Ursachen der Hyperkinetischen Störung können weitgehend ad acta gelegt
werden und haben allenfalls einen beschränkten zusätzlichen
Erklärungswert. Dazu zählen einerseits sozioevolutionäre Modelle, die
in der Störung ein Überbleibsel früherer mutmaßlich gesellschaftlich
sinnvoller Verhaltensweisen sehen, sowie sozialisationstheoretische
Ansätze, die eine eigentliche Verursachung der Störung durch die Umwelt,
insbesondere durch eine ungeeignete Erziehung der Kinder behaupten. Dazu
zählen andererseits aber auch weitestgehend biologisch orientierte
Konzepte wie die Annahme von Allergien oder Reaktionen auf unverträgliche
Substanzen in Nahrung und Umwelt. Sie alle können durch die gezielte
Veränderungen der von ihnen angenommenen Ursachen zwar einzelne Symptome
zu mehr oder minder großen Teilen beeinflussen, nicht aber die Hyperkinetische
Störung als Einheit in ihrer Kultur und Biologie übergreifenden
Symptomatik erklären. Ihr "Fehler" liegt in der Suche nach
Ursachen, die einen unmittelbaren eindeutigen Effekt auf das Verhalten der
Betroffenen haben, statt von einer Störung auszugehen, welche die
individuelle Anpassung des Einzelnen an die jeweils gegebenen
Umweltbedingungen behindert.
Natürlich wird auch die aktuelle wissenschaftliche Vorstellung der
Hyperkinetischen Störung und ihrer Ursachen nicht zeitlos bestehen
bleiben. Dennoch ist sie schon heute so ausgereift und detailliert, dass
sie die Grundlage einer genauen und ihrer Verantwortung bewussten Diagnostik
und Therapie sein kann. Verallgemeinernde
Aussagen, welche jede Kenntnis der Ursachen dieser Verhaltensstörung
leugnen oder auch die medizinische wie psychologische Therapie insgesamt
infrage stellen, sind unlauter, da sie sich nicht auf die vorliegenden
Befunde stützen. Wie notwendig vertiefte Kenntnisse sind - so sehr sich
das aktuelle Interesse an der Hyperkinetischen Störung auch aus den
Problemen gerade unserer modernen Industriegesellschaften mit
unaufmerksamem, unruhigem und impulsivem Verhalten nähren mag -, zeigt
nicht zuletzt die Polemik, mit der diese Störung mehr als jede andere in
der Öffentlichkeit diskutiert und durch Vertreter vielfältiger Verbände
politischer und wirtschaftlicher Natur in deren Interesse vereinnahmt
wird. Darunter leiden nicht nur die Betroffenen, deren augenblickliche Not
zum Spielball und Faustpfand zukünftiger sozialer Reformen gemacht wird -
darunter leidet auch eine Gesellschaft, die durch die wachsenden
Freiheiten des Einzelnen mehr denn je auf seine Selbstkontrolle angewiesen
ist.
|
|

|
Weitere Informationen zur Hyperkinetischen
Störung
|
|
Symptome der Störung |
|
|
Diagnose der Störung |
|
|
Therapieformen |
|
|
|
|
|
Verweise auf Fachliteratur
|
|
|
(1) |
Still, G.F. (1902). Some
abnormal psychical conditions in children. In: Lancet 1
S.1008-1012, 1077-1082, 1163-1168 |
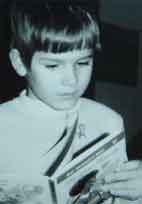
Ich weiß es nicht, weiß im Grunde in all meinem Alter nicht mehr als zu
Kinderzeiten zu wissen war. Bin ich denn reifer geworden durch die vielen
Tage, in denen meine Sinne eine Welt aufnahmen, die sich dem Verstehen der
Menschen entzieht? Nicht weiter ist mein Blick geworden, dass ich mehr
sehe als je zuvor, doch nur allenfalls durchdringender, schärfer aus
Schulung, unterscheidender und bewusster. Aber die Schule war
ganz eigen, ein geschlossener Raum ohne Fenster, ein komplexes, bis in
hinterste Windungen durchdachtes System, ein Modell freilich, dessen äußere
Grenzen der denkenden menschlichen Mitte entwucherten, bis dass sie,
unabsehbar am Ende der hypertrophierenden Formel mitwachsend, zur
Negierung mehr als genügend entrückt schienen. Im Mikrokosmos der
unendlich zu stückelnden Kleinheit erwuchs mir und allen ein Abbild des
universalen Großen, das mehr und mehr zu durchschauen unserem eitlen
Fortschrittsglauben gefiel wie ein rasches Erwachsenwerden und
Emanzipieren. Wie überheblich aus der Sicht des Ganzen, das es
nicht zu greifen und schwerlich vorzustellen gibt, weil wir mit jeder
Spaltung der Durchdringung doch nur an Einzelheiten rätseln und auch
nicht zweierlei des Kleinsten uns Bekannten aufzureihen wissen! Für jedes
Modell finden wir eine Ordnung, ja es wird in seinem Wesen selbst zu ihr,
zuletzt von den Philosophen gar zur Folge der Ordnungen verkehrt, die
diese in ihren gefesselten Geistern entwerfen. Natürlich wissen wir, dass
die Zusammenfassung der Modelle kein Modell mehr sein darf, dass, weil wir
Menschen Schöpfer mit faktischem, immanentem Sein sind, über dem
Transzendenten die Determination des Vorhandenen steht. Doch das
Unbegreifliche verfängt sich in der Vorstellung, kommt nicht über
sie hinaus, und so steht über all den Modellen und Ordnungen, die wir uns
im Entdeckerglauben schufen, wieder
nur ein Modell, - das Weltmodell.
Vielleicht
mag es dem einen oder anderen obskur und unrecht erscheinen, den relativen
Fortschritt der Menschheit, der so offensichtlich nicht zu bestreiten sei,
um des geringen absoluten Fortschritts zu verwerfen. Immer, das sage auch
ich mir, gibt es etwas zu verbessern, was bedeutet, dass das
wahrhaft Gute in unendlicher Ferne liegt. Dem Unendlichen aber kann man
sich nicht nähern, und so fürchte auch ich die Entwertung jeder Bemühung
aus der Größe des Ideals. [...]
Wir alle
leben nach einem bestimmten Lebensschema, das die Erfahrung mit der Welt
und uns selbst entworfen hat, das uns in Situationen führt und
Augenblicke auf einzigartig freie und doch vorgezeichnete Art durchleben lässt.
Unser Sein wird auf tausendfach in sich selbst reflektierte Weise ein
Bewusstsein, das als Modell Denken und Handeln in stets antizipierender
und trotzdem gegenwärtiger Führung vorantreibt. Ich lebe aus meinem
Modell, dem meines Erfassens und dem Weltmodell, das die Menschheit
sich in Zivilisation, Wissenschaft und Kultur geschaffen hat, lebe aus den
ordnenden und regelnden Prinzipien meiner Zeit, lebe aus der Ordnung
selbst. Ich kann nicht umhin, dass mein Sein das Wundmal meiner Beschränktheit
trägt, die mehr ist als nur die Begrenzung durch das Vorhandene,
durch mein ins Leben gestelltes Dasein. Alles was ich tue, und auch jenes,
das ich sein lasse, mein Reden und mein Schweigen, mein Denken und meine
vielfältige Unberührtheit, alles ist gezeichnet mit den Spuren meiner
Wesenhaftigkeit, die ideell fortlebt in den materiellen und immateriellen
Dingen, deren Ursprung ich war.
Joshua Cyriac
Tom (1989) S.61f.
|
| (2) |
Moll, G.H; Rothenberger, A. (2001). Neurobiologische Grundlagen. Ein
pathophysiologisches Erklärungsmodell der ADHD. In: Kinderärztliche
Praxis. Sonderheft "Unaufmerksam und hyperaktiv", S.9-15 |
| (3) |
Brand, C. (1995). Cyril Burt:
Fraud or Framed? A Review. In: Nature 377, S.394-395 |
| (4) |
Rutter, M.; Silberg, J.;
O'Connor, T.; Simonoff, E. (1999). Genetics and Child Psychiatry: II
Empirical Research Findings. In: Journal of Child Psychology and
Psychiatry 40/1, S.19-55 |
| (5) |
Hartmann, T. (1993). Attention
Deficit Disorder - A Different Perception. Montpelier VT: Mythical
Intelligence Inc.
deutsch: Hartmann, T. (1997). ADD - Eine andere Art, die Welt zu sehen.
Lübeck: Schmidt-Römhild
Inzwischen ist in den USA eine erneuerte und erweiterte Auflage des Buches
erhältlich, die durch E.M. Hallowell (Driven to Distraction -
Zwanghaft zerstreut) eingeleitet wird. |
| (6) |
Jensen, P.S. et al. (1997). Evolution and Revolution in Chuld
Psychiatry: ADHD as a Disorder of Adaptation. In: Journal of the
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 36/12, S.1672-1679 |
| (7) |
Haeckel, E. (1868). Natürliche
Schöpfungsgeschichte. Berlin: Reimer. Die Darstellung der Ontogenese
erfolgt im 12. Vortrag; die Parallelisierung der ontogenetischen und
phylogenetischen Stadien nach J. Streif. |
| (8) |
Bischof-Köhler, D. (1985). Zur
Phylogenese menschlicher Motivation. In: Eckensberger, L.H.;
Lantermann, E.-D. (Hrsg.) Emotion und Reflexivität. Wien: Urban
und Schwarzenberg, S.3-47
Eibl-Eibesfeld, I. (1984). Die Biologie menschlichen Verhaltens. München:
Piper
Krause, R. (1983). Zur Onto- und Phylogenese des Affektsystems und
ihrer Beziehungen zu psychischen Störungen. In: Psyche 37,
S.1015-1043
Resch, F. (1996). Entwicklungspsychopathologie des Kindes und
Jugendalters. Weinheim: Beltz PVU, v.a. S.113-127 (Exkurs: Zur
Phylogenese des Denkens) |
| (9) |
Dresel S.; Krause, J.; Krause,
K.-H.; LaFougere, C.; Brinkbaumer, K.; Kung, H.-F.; Hahn, K.; Tatsch, K.
(2000). Attention deficit hyperactivity disorder: binding of
[99mTc]TRODAT-1 to the dopamine transporter before and after
methylphenidate treatment. In: European Journal of Nuclear Medicin 27/10,
S.1518-1524
Moll, G.H.; Wicker, M.; Bock, N.; Rüther, E.; Rothenberger, A.; Huether,
G. (2000). Age-associated changes in the densities of presynaptic
monoamine transporters in different regions of the rat brain from early
juvenile life to late adulthood. In: Developmental Brain Research
119, S. 251-257 |
| (10) |
Barkley, R.A. (1997). ADHD and
the Nature of Self-control. New York: Guilford Press; eine
populärwissenschaftliche Zusammenfassung auf Deutsch in:
Barkley, R.A. (1999). Hyperaktive Kinder. In: Spektrum der
Wissenschaft 3, S.30-36 |
| (11) |
Moll, G.H.; Hause, S.; Rüther, E.; Rothenberger, A.; Huether, G. (2001).
Early Methylphenidate Administration to Young Rats Causes a Persistent
Reduction in the Density of Striatal Dopamin Transporters. In: Jornal
of Child and Adolescent Psychopharmacoloy 11/1, S.15-24
|
| (12) |
Hüther, G.; Bonney, H. (2002). Neues
vom Zappelphilipp: ADS/ADHS verstehen, vorbeugen und behandeln.
Düsseldorf: Walter. |
| (13) |
Trott, G.-E. (1993). Das
hyperkinetische Syndrom und seine medikamentöse Behandlung.
Heidelberg: Barth. |
| (14) |
Biederman, J.; Wilens, T.; Mick,
E.; Spencer, T.; Faraone, S. (1999). Pharmacotherapy of
Attention-deficit/ Hyperactivity Disorder Reduces Risk for Substance Use
Disorder. In: Pediatrics 104/2, S.E20
Huss, M.; Schmidt-Schulz, A.; Hoffmann, K.; Vogel, R.; Lehmkuhl, U.
(2000). Wenn ADS »erwachsen« wird - Langzeitverläufe von Kindern mit
Aufmerksamkeitsdefizit- Syndrom (ADS): Macht Ritalin süchtig? In:
Fitzner, T.; Stark, W. (Hrsg.) ADS: verstehen - akzeptieren - helfen.
Weinheim: Beltz, S.184-194 |
| (15) |
Zerbe, R.L.; Rowe, H.; Enas, G.G.;
Wong, D.; Farid, N.; Lemberger, L. (1985). Clinical pharmacology of
tomoxetine, a potential antidepressant. In: Journal of Pharmacology
and Experimental Therapeutics 232/1, S.139-143
Michelson, D.; Fries, D.; Wernicke, J.; Kelsey, D.; Kendrick, K.; Sallee,
F.R.; Spencer, T. (2001). Atomoxetine in the treatment of children and
adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder - a randomized,
placebo-controlled, dose-response study. In: Pediatrics 108/5,
S.E83 [Diese Studie wurde von den Lilly Research Laboratories in
Zusammenarbeit mit der Indiana University School of Medicine
durchgeführt] |
| (16) |
Egger, J. (2000). Möglichkeiten
von Diätbehandlungen bei hyperkinetischen Störungen. In:
Steinhausen. H.-C. (Hrsg.) Hyperkinetische Störungen bei Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen. Stuttgart: Kohlhammer, S.117-126
Schmidt, M.H.; Egger, J. (1998). Die Wirksamkeit einer oligoantigenen
Diät bei Kindern mit expansiven Verhaltensstörungen. Köln:
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Als Beispiel für Erziehungsratgeber:
Calatin, A. (1992). Das hyperaktive Kind. Ursachen, Erscheinungsformen
und Behandlung. München: Heyne
Rosival, V. (1992). Hyperaktivität natürlich behandeln. München:
Gräfe und Unzer |
| (17) |
Pastor, P.N. (2002). Attention
Deficit Disorder and Learning Disability: United States, 1997-98.
Department of Health and Human Services. Centers of Disease Control and
Prevention. National Center for Health Statistics. In: Vital and Health
Statistics 10/206 |
| (18) |
Mick, E.; Biederman, J.; Faraone, S.V.; Sayer,
J.; Kleinman, S. (2002). Case-control study of attention-deficit
hyperactivity disorder and maternal smoking, alcohol use, and drug use
during pregnancy. In: Journal of the American Academy for Child and
Adolescent Psychiatry 41/4, S.378-385 |
| (19) |
Gottman, J.M.; Katz, L.F.; Hooven, C. (1997).
Meta- Emotion. How Families Communicate Emotionally. Mahwah NJ:
Lawrence Erlbaum Associates |
| (20) |
Baumrind, D. (1965). Parental control and
parental love. In: Children 12, S.230-234
Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child
behavior. In: Child Development 37/4, S.887-907 |
| (21) |
Eine Übertragung des Interviews ins
Deutsche sowie eine Überarbeitung erfolgte 1999 durch
Schmidt, M.; Brinkmann, A.; Lukas, C.; Streif, J. (1999). Meta-Emotion-Interview.
Erwachsene / Jugendliche. Interviewleitfaden - unveröffentlichtes
Typoskript. München: Ludwig-Maximilians-Universität
Eine Übertragung des Meta-Emotion Coding System von Hooven, C.
(1994) The Meta-Emotion Coding System. Coding Manual.
Unveröffentlichtes Typoskript, erfolgte 1999 durch Streif, J.; Erweiterung
und erste Anwendung in der Diplomarbeit von
Streif, J. (1999). Meta-Emotion: Emotionale Kommunikation in Familien
mit hyperkinetischen Kindern. Diplomarbeit. München:
Ludwig-Maximilians- Universität. |
| (22) |
Gottman,
J.M.; Wilson, B.J. (1996). Attention – The Shuttle Between Emotion
and Cognition: Risk, Resiliency, and Physiological Bases. In:
Hetherington, E.; Blechman, E.A. (Hrsg.) Stress, Coping, and Resiliency
in Children and Families. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates, S.189-228.
Vgl. auch (19) S.120f. |
| (23) |
Porges,
S.W.; Raskin, D.C. (1969). Respiratory and heart rate components of
attention. In: Journal of Experimental Psychology 81, S.497-503
Porges, S.W.; Walter, G.F.; Korb, R.J.; Sprague, R.L. (1975). The
influence of methylphenidate on heart rate and behavioral measures of
attention in hyperactive children. In: Child Development 46, S.727-733
Porges, S.W. (1991). Autonomic regulation and attention. In: Campbell, B.A.; Hayne, H.;
Richardson, R. (Hrsg.) Attention and information processing in infants
and adults. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates, S.201-223
Porges, S.W.; Doussard-Roosevelt, J.A.; Portales, A.L.; Suess, A. (1994). Cardiac
vagal tone: Stability and relation to difficultness in infants and
3-year-olds. In: Developmental Psychobiology 27, S.289-300
Degangi, G.A.; DiPietro, J.A.; Greenspan, S.I.; Porges, S.W. (1991). Psychophysiological
characteristics of the regulatory disordered infant. In: Infant
Behavior and Development 14, S.37-50 |
| (24) |
Eichlseder, W. (1996). Unkonzentriert?
Hilfen für hyperaktive Kinder und ihre Eltern. 4. Aufl. Weinheim:
Beltz, S.110 |
| (25) |
Barkley, R.A. (1997). ADHD and
the Nature of Self-control. New York: Guilford Press, S.319 |
| (26) |
Bindungstheorie:
Bowlby, J. (1969) Attachment. Attachment and loss (1).
London: Hogarth Press / New York: Basic Books
Bowlby, J. (1973) Separation: Anxiety & Anger. Attachment
and loss (2). London: Hogarth Press / New York: Basic Books
Grossmann, Kl.E.; Grossmann, Ka.E. (2001). Bindungsqualität und
Bindungsrepräsentation über den Lebenslauf. In: Röper, G.; von
Hagen, C.; Noam, G. (Hrsg.) Entwicklung und Risiko. Perspektiven einer
Klinischen Entwicklungspsychologie. Stuttgart: Kohlhammer, S. 143-168
Antisozialisationshypothese:
Harris, J.R. (2000). Ist Erziehung sinnlos? Die Ohnmacht der Eltern.
Hamburg: Rowohlt |
|
|
|
 |
zum Seitenanfang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
