|
| |
|
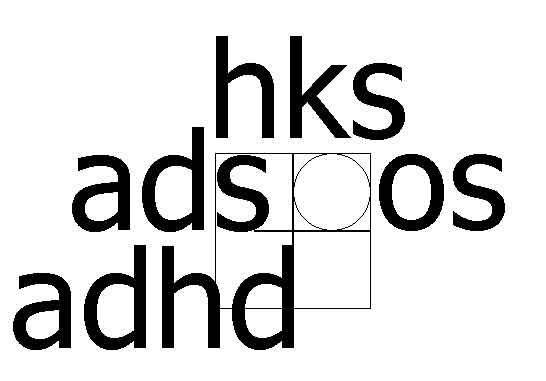
|
Von den
Namen
einer Störung |
|
|
|
|
|
Obwohl das Phänomen impulsiven, überaktiven und
unaufmerksamen Verhaltens bei Kindern bereits durch den Frankfurter
Psychiater Heinrich Hoffmann (1), den Autor des Struwwelpeter,
dargestellt und 1902 von George Still (2) erstmals umfassend beschrieben
wurde, ist die Hyperkinetische Störung als eigenständiges
psychiatrisches Störungsbild erst seit Mitte des vorigen Jahrhunderts
anerkannt. Die massive Erforschung der Verhaltensstörung nicht zuletzt
vor dem Hintergrund seiner v.a. in den Medien umstrittenen medikamentösen
Therapie setzte in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts ein. Heute gilt
die Hyperkinetische Störung (WHO) bzw. Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
(APA) als eine der am häufigsten wissenschaftlich untersuchten
Krankheiten mit Auftreten im Kindes- und Jugendalter. Der zur
medikamentösen Behandlung der Störung eingesetzte Wirkstoff
Methylphenidat (Ritalin / Medikinet / Equasym) ist das bestuntersuchte
Medikament der Kinderheilkunde. |
 |
Der Begriff der Störung
|
|

|
Im Laufe der Jahre wurde die Hyperkinetische Störung bzw.
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung mit einer Reihe von Namen
belegt, die durchaus auch Programm für das jeweilige Verständnis der
Pathologie waren. |
"Ob der
Philipp heute still
Wohl bei Tische sitzen will?"
Also sprach in ernstem Ton
Der Papa zu seinem Sohn. |
|
Zu den ältesten diesbezüglichen Konzepten zählt jenes der Minimalen
cerebralen Dysfunktion (MCD). Idee dieser fragwürdigen
Gleichsetzung von Hyperaktivität und Hirnfunktionsstörung war, dass das
hyperkinetische Verhalten durch einen minimalen, anatomisch nicht
nachweisbaren Hirndefekt verursacht würde, für den man i.d.R. frühkindliche
Hirnschädigungen - daher auch Brain Injured Child Syndrome -
verantwortlich machte. (3) Die Begriffe Minimal Brain Damage (seit
1947) bzw. Minimal Brain Dysfunction (seit 1962) entstanden im
angelsächsischen Raum, wo man seit den 1930er Jahren zunächst von Organic
Drivenness gesprochen hatte. (4) In der deutschsprachigen Schweiz
etablierte sich für MCD auch der Begriff des Psychoorganischen
Syndroms (POS). Die erste exakte Beschreibung hyperkinetischen
Verhaltens durch Still, der hellsichtig von einem Defect of Volitional
Inhibition sprach, fand begrifflich keinen Niederschlag in der
Geschichte der Störung.
(2)
Nach 1970 ging die wissenschaftliche Literatur zur
Hyperkinetischen Störung zunehmend dazu über, vom Hyperkinetischen
Syndrom (HKS) zu sprechen. Dieser Terminus, heute als Syndrom
oder Störung weltweit die verbreitetste Bezeichnung der
Verhaltensstörung (5) und noch immer gängige Diagnose in der Internationalen
Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10 Kapitel F von 1992) der
Weltgesundheitsorganisation (WHO), macht ein Kernsymptom zum Namen der
Gesamtstörung. Das scheint insofern sinnvoll, als eine genaue Kenntnis
des Zusammenhangs von Aufmerksamkeitsstörung und Hyperaktivität bislang
nicht gegeben ist, pathologische Aufmerksamkeitsprozesse jedoch weitgehend
unspezifisch bei einer Vielzahl von psychischen Störungen zu beobachten
sind. (6) Ein Problem der begrifflichen Verengung der Perspektive
auf den Aspekt der Hyperaktivität resultiert allerdings aus dem falschen
Umkehrschluss, die Beeinträchtigung durch die Störung ende insgesamt mit
dem Nachlassen der hyperaktiven Symptomatik im Jugend- und
Erwachsenenalter. (7)
Im Jahr 1980 setzte sich in den USA mit der Veröffentlichung
der dritten Ausgabe des Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM-III) der American Psychiatric Association (APA)
eine neue Bezeichnung der Störung durch, welche - ungeachtet der ätiologischen
Unklarheiten - die Aufmerksamkeitsstörung zum Leitsymptom erklärte, zu
welcher das Symptom der Hyperaktivität hinzutreten könne, nicht aber müsse.
(8) Die Kategorien der Störung lauteten künftig Attention Deficit
Disorder with/without Hyperactivity (ADD/H). In der
Revision dieser Ausgabe sieben Jahre später wurden die Symptomgruppen des
Aufmerksamkeitsdefizits einerseits sowie der Hyperaktivität andererseits
jedoch wieder zu einem einzigen Syndrom zusammengezogen, das nun Attention
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) genannt wurde. (9) Die
derzeit gültige vierte Ausgabe des Manuals brachte 1994 schließlich
erneut eine symptomatische Differenzierung zwischen Aufmerksamkeits- und
Hyperaktivitätsstörung, wobei es nun möglich war, Tendenzen dominanter
Unaufmerksamkeit bzw. Hyperaktivität und Impulsivität
andererseits zu diagnostizieren. (10)
Die deutschen Bezeichnungen Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit/ohne
Hyperaktivität (ADS/H) bzw. Aufmerksamkeitsdefizit-/
Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bzw. sind Übertragungen
der amerikanischen Begriffe. Zwar haben diese Termini noch keinen Eingang
in den vom ICD-10 bestimmten diagnostischen Alltagsgebrauch gefunden, doch
werden sie durch die traditionell stärker am DSM orientierte
Forschungsliteratur zunehmend gebräuchlich. Populärwissenschaftliche
Publikationen greifen demgegenüber - zumindest vorderhand in ihren Titeln
- noch immer häufig auf die griffigere Formel der Hyperaktivität zurück
bzw. sprechen in einem aktuellen Fokus auf die Aufmerksamkeitsdefizite
vereinfacht von Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS). Da vor allem
die Kriterien hyperaktiven Verhaltens im Zusammenhang mit der Diagnose
Erwachsener eine Abstraktion von kindlichen Diagnoseschemata verlangen,
erscheint der Übergang zur amerikanischen Terminologie auch aus Gründen
der Genauigkeit des Begriffs für die bezeichnete Störung sowie im
Interesse der Akzeptanz durch Betroffene und Gesellschaft sinnvoll.
|
Und die Mutter blickte
stumm
Auf dem ganzen Tisch
herum.
Doch der Philipp hörte
nicht,
Was zu ihm der Vater
spricht.
Er gaukelt
Und schaukelt,
Er trappelt
Und zappelt
Auf dem Stuhle hin und her.
"Philipp, das missfällt mir
sehr !"
Heinrich Hoffmann
Der Struwwelpeter. Lustige Geschichten und drollige Bilder für
Kinder von 3 bis 6 Jahren (1845),
|
 |
Anmerkungen zu Historie und konzeptueller Abgrenzung der Begriffe
|
|
|

|
Namen mögen nicht selten austauschbare Zeichen sein,
doch im Fall psychopathologischer Diagnosen sind sie stets auch Begriffe -
Hinweise auf das Verständnisses der Medizin und Psychologie, aber auch
Stigmata im Verständnis der betroffenen Symptomträger. |
Katthult
war ein kleiner hübscher Hof mit einem rot gestrichenen Haus, das
zwischen Apfelbäumen und Flieder auf einer Anhöhe lag. Und rundherum gab
es Äcker und Wiesen und Haine, einen See und einen großen, großen Wald.
Es hätte ruhig und friedvoll auf Katthult sein können, wenn Michel
nicht gewesen wäre.
"Er macht immer nur Unfug, dieser Junge",
sagte Lina. "Und wenn er selbst keinen Unfug macht, passiert trotzdem
noch genug mit Michel. So einen Bengel wie den hab ich noch nie
gesehen."
Aber Michels Mama nahm ihn in Schutz. "Es ist
doch nicht so schlimm mit Michel", sagte sie. "Heute hat er Ida
nur einmal gekniffen und die Kaffeesahne verschüttet, das war alles - ja,
und die Katze hat er ums Hühnerhaus gejagt, das ist wahr. Aber auf jeden
Fall finde ich, er fängt an ruhiger und artiger zu werden."
Michel war nicht boshaft, das kann man nicht sagen.
Er mochte beide sehr gern, Ida und die Katze. Aber er musste Ida einfach
ein bisschen kneifen, sonst hätte sie ihm ihr Sirupbrot nicht gegeben,
und die Katze jagte er in aller Freundlichkeit, nur um zu sehen, ob er
genauso schnell laufen konnte wie eine Katze. Aber das konnte die Katze
nicht begreifen.
Astrid Lindgren
Michel aus Lönneberga (1963), zitiert nach:
Immer dieser Michel
Oetinger (1998) S.13f. |
|
Die "Entdeckung der Hyperkinese" ist, behält man die heute
weitgehend anerkannte genetische Disposition der Störung im Bewusstsein,
v.a. eine Geschichte der Wahrnehmungsänderung, zweifellos auch unter der
Voraussetzung pharmakologischer Beeinflussung des wahrgenommenen
Verhaltens. (11) Erst die soziale Organisation der westlichen
Industriegesellschaften des 19. und 20. Jahrhunderts, welche in der
zunehmenden Individualisierung der Bürger bislang unbekannte
Anforderungen an die eigenmotivierte Selbstkontrolle stellte, ließ
das spezifische Profil einer Störung erkennen, die es bereits Kindern
erschwert, die für ihr Alter geforderte Kontrolle zu erlangen. Durch die
weitere Zunahme der Stadtbevölkerung wuchs anteilsmäßig auch die Zahl
der betroffenen Kinder in städtischen Lebenswelten, die naturgemäß
weniger Freiräume für das Ausleben kindlicher Aktivität bieten.
Zugleich kam es insbesondere nach dem Zweiten
Weltkrieg zu massiven Wandlungen in der familiären wie institutionellen
Erziehung. Permissive Erziehungsstile, d.h. die Kinder verstärkt gewähren
lassende Formen der Erziehung, nahmen deutlich zu. So wünschenswert
die veränderte Erziehungshaltung nach den Erfahrungen autoritärer
Erziehung in den Jahrhunderten zuvor war, so entließ sie die betroffenen
Kinder doch vielfach aus den restriktiven Lernumgebungen, die für diese
Kinder zum Erwerb von Kontrollkompetenzen in besonderem Maße notwendig
sind. (12) Es überrascht daher wenig - und spricht auch nicht für eine
übermäßige Maßregelung oder gar eine soziale Verursachung der
Hyperaktivität -, dass die Hyperkinetische Störung heute als häufigster
Vorstellungsgrund ins Zentrum des kinder- und jugendpsychiatrischen
Alltags gerückt ist. (13) Darüber hinaus unterstreicht diese Entwicklung
die aktuelle Notwendigkeit, trotz der veränderten sozialen Wahrnehmung
gerade die Verhaltensstörung zu behandeln, da sie, ungeachtet aller
berechtigten Forderungen beispielsweise nach Reformen im Schulsektor, zur
sozialen Diskreditierung des Kindes, aber auch der Familie insgesamt führen
kann. (14) Mag die "Entdeckung der Hyperkinese" also tatsächlich
eher ein soziales Problem als eine bislang unbekannte individuelle
Pathologie sein: sie bleibt dennoch das Leid der Betroffenen.
|
|

|
Welche Implikationen hat nun aber der Umstand, dass der
Begriff des Hyperkinetischen Störung im Alltag nach und nach von
dem der Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS) abgelöst
wird? |
|
Zweifellos wird die mangelnde Aufmerksamkeitssteuerung dort zum größeren
Problem, wo alltägliche Situationen in Arbeit und Verkehr die konstante,
weniger aktive und gestaltende als vielmehr passive und kontrollierende
Hinwendung zu oft gleichförmigen Prozessen verlangen. (15) Dennoch
scheint hier nicht in gleicher Weise ein soziales Interesse an Diagnose
und Therapie gegeben wie im Fall der Verhaltensstörung. Nicht zuletzt
die höhere Prävalenzrate betroffener Jungen gegenüber den Mädchen bei
mutmaßlich ähnlicher genetischer Veranlagung legt nahe, dass die -
auch aus Sozialisationsgründen - überwiegende Hyperaktivität der Jungen
bzw. Männer in der Gesellschaft auf mehr Resonanz stößt als das
Aufmerksamkeitsdefizit.
Eine Thematisierung des Aufmerksamkeitsaspekts ist hingegen nicht nur
wissenschaftlich im Sinne einer fraglichen gemeinsamen Ursache der
Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung wichtig, sondern wird
insbesondere von den Erwachsenen unter den Betroffenen, häufig Eltern
hyperaktiver Kinder, begrüßt. Die amerikanische Selbsthilfeorganisation Children
and Adults with Attentional Disorders (CHADD) gehört mittlerweile zu
den größten Selbsthilfeorganisationen des Landes. Sie erkämpfte
zahlreiche rechtliche Begünstigungen v.a. im amerikanischen
Bildungssystem und hat erheblichen Einfluss auf die öffentliche
Diskussion der Problematik. Obschon die Aufmerksamkeitsdefizitstörung
medizinisch jenseits einer selten eindeutigen Symptomatik noch
immer schwer zu greifen ist, sehen mehr und mehr Menschen die Ursache ihrer
selbstempfundenen Leistungsprobleme im beruflichen wie familiären Bereich
als Folge des Leidens an ADS. (16)
Eine negative Konsequenz dieses in seinem Akzent neuen Störungsbegriffes
mag also sein, dass er zu einer Verengung der Perspektive führt. Er
reduziert die in der Impulsivität und Hyperaktivität sichtbaren sozialen
Bedingungen, unter welchen die Störung auftritt, auf das subjektive
Empfinden individueller Leistungspotenziale, die einer Überprüfung
meist nicht zugänglich sind. Während die Stimmen jener Kritiker leiser
werden, welche eine von außen an die Kinder herangetragene "Medizinisierung
abweichenden Verhaltens" beklagen, bildet sich eine neue (erwachsene)
Klientengruppe, die von sich aus das Label der Störung zu tragen gewillt
ist, um sich helfen zu lassen. (11) Ironisch könnte man anmerken, die
problematische Verhaltensstörung mutierte zu einer in ihrem Begriff
wünschenswerten Verhaltensvariante, da sie scheinbar zu erklären
vermag, warum viele betroffene (?) Menschen die selbstgesteckten
Lebensziele nicht erreichen. (17) Welchen Einfluss dies in Zukunft auf den
gesellschaftlichen Umgang mit dem "hyperkinetischen
Problemverhalten" haben wird, bleibt freilich offen.
|
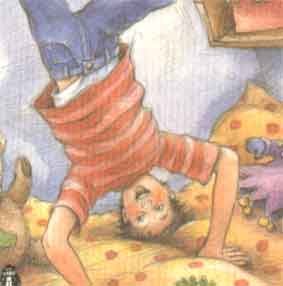
"Du bist ein Ekel-Paket", sagt Mama. Sie
hebt Hannes wie einen Sack über die Schulter und schleppt ihn in die
Küche. Mama ist nicht gerade stark, aber Hannes kann sie mühelos tragen.
Hannes wiegt nicht viel. Er hat dünne Arme, dünne Beine und einen
dünnen Körper.
"Zappeldürr", sagt Papa.
"Mager bis knochig", sagt Onkel Theo.
"Streichholzfabrik", ruft Steffie hinter Hannes her.
Abends, vorm Einschlafen, spielt Mama manchmal
Rippenzählen bei Hannes. Zuerst fährt sie mit dem Finger an der rechten
Seite des Brustkorbs nach unten und an der linken Seite wieder hoch. Bei
jedem Huppel zählt sie. "Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
sieben." Dann dreht sich Hannes auf den Bauch und Mama zählt den
Rücken rauf und runter. Hannes liegt ganz still. So still liegt er sonst
nie. Sonst ist immer etwas an ihm in Bewegung. Die Füße, die Hände, der
Po, der Kopf. Nicht mal nachts kann Hannes ruhig liegen. Im Schlaf mahlen
seine Zähne aufeinander, bis es knirscht. Er presst seinen Kopf ins
Kissen und wirft ihn hin und her, do dass die Haare auf dem Hinterkopf
völlig verfilzt sind. Sie stehen ab wie struppige Igelstacheln.
Beim Rippenzählen rührt sich nichts an Hannes. |
|
Verweise auf Fachliteratur |
|
(1) |
Hoffmann,
H. (1845). Struwwelpeter: Lustige Geschichten
und drollige Bilder für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Verfasst und
gezeichnet für seinen Sohn Carl. Erstveröffentlichung: Literarische
Anstalt J. Rütten, Frankfurt. |
Regina Rusch
Zappelhannes
Weinheim (1997) Beltz |
| (2) |
Still, G.F. (1902). Some
abnormal psychical conditions in children. In: Lancet 1
S.1008-1012, 1077-1082, 1163-1168. |
|
| (3) |
Steinhausen, H.-C. (1995). Hyperkinetische
Störungen - eine klinische Einführung. In: Steinhausen, H.-C.
(Hrsg.) Hyperkinetische Störungen im Kindes- und Jugendalter. Stuttgart:
Kohlhammer, S.11-13. |
|
| (4) |
Barkley, R.A. (1997). ADHD and
the nature of self-control. New York: Guilford Press, S. 4ff. |
|
| (5) |
World Health Organization (1997).
Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V
(F). Hrsg. von Dilling, H.; Mombour, W.; Schmidt, M.H. 2. Aufl. Bern:
Hans Huber, S.293ff. |
|
| (6) |
Döpfner, M.; Schürmann, S.;
Lehmkuhl, G. (1998). Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem
und oppositionellem Problemverhalten THOP. 2. Aufl. Weinheim: Beltz
PVU, S.1f. |
|
| (7) |
Neuhaus, C. (1996). Das
hyperaktive Kind und seine Probleme. Ravensburg: Ravensburger Verlag,
14f.
Neuhaus, C. (2000). Hyperaktive Jugendliche und ihre Probleme. Ravensburg:
Urania-Ravensburger, S.17ff. |
|
| (8) |
American Psychiartric Association
APA (1980). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
DSM-III. Washington: APA |
|
| (9) |
American Psychiartric Association
APA (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
DSM-III-R. Washington: APA |
|
| (10) |
American Psychiartric Association
APA (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
DSM-IV. Washington: APA
Deutsche Ausgabe: American Psychiatric Assocation (1997). Diagnostisches
und statistisches Manual psychischer Störungen. Dt. Bearbeitung von
Saß, H.; Wittchen, H.-U.; Zaudig, M. Göttingen: Hogrefe. |
|
| (11) |
Conrad, P. (1990). Die
Entdeckung der Hyperkinese. Anmerkungen zur Midizinisierung abweichenden
Verhaltens. In: Voss, R. (Hrsg.) Pillen für den Störenfried? 2.
Aufl. München: Ernst Reinhardt, S.97-109. |
|
| (12) |
Gottman, J.M. (1997). Kinder
brauchen emotionale Intelligenz. Ein Praxisbuch für Eltern. 2. Aufl.
München: Heyne, S.138ff. |
|
| (13) |
Döpfner, M.; Lehmkuhl, G.
(1998). Die multimodale Therapie von Kindern mit hyperkinetischen
Störungen. In: Der Kinderarzt 2 S.171-181 und 3 S.331-334. |
|
| (14) |
Krause, J. (1995). Leben mit
hyperaktiven Kindern. München: Piper / C&H, S.67ff. Inzwischen
liegen die Rechte für dieses Werk wieder bei der Autorin; es wird vom
Bundesverband Aufmerksamkeitsstörung / Hyperaktivität (BvAH) vertrieben. |
|
| (15) |
Ratey, J.J.; Hallowell, E.M.
(1995). Driven to Distraction. New York: Touchstone - Simon &
Schuster, S.70ff.
Eine deutsche Übersetzung des Werkes erschien 1999 unter dem Titel Zwanghaft
zerstreut. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch-Verlag. |
|
| (16) |
Barkley (vgl. Fußnote 4)
S.22ff., 256ff. |
|
| (17) |
Hartmann, T. (1997). ADD - Eine andere Art, die Welt zu sehen. 2.
Aufl. Lübeck: Schmidt-Römhild.
Jensen, P.S. et al. (1997). Evolution and Revolution in Chuld
Psychiatry: ADHD as a Disorder of Adaptation. In: Journal of the
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 36/12, S.1672-1679. |
|
|
|
|
|

|
nach oben |
|
|
|
|
|
